
| Home
| Archiv
| Impressum 14. Februar 1998, von Michael Schöfer Arbeitslosenrepublik Deutschland Was der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit, Bernhard Jagoda, am 5. Februar zu verkünden hatte, schlug in Deutschland ein wie eine Bombe: 4,823 Mio. Arbeitslose im Januar 1998 - soviel wie noch nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik. Und auf das Überschreiten der 5 Millionen-Grenze wird man womöglich nicht lange warten müssen. Demgegenüber ist am Aktienmarkt - trotz Asienkrise - ein unvergleichlicher Höhenflug zu verzeichnen, denn wenige Tage nach Verkündung des Arbeitslosenrekords erreichte der Deutsche Aktenindex (DAX) mit 4588,43 Punkten (11.02.1998) sein historisches Hoch. Die Gewinner und Verlierer einer nach wie vor als "sozial" bezeichneten Marktwirtschaft stehen somit eindeutig fest. Doch an diesem Spannungsverhältnis droht unser Gemeinwesen zu zerreißen. Schon sind, inspiriert durch das französische Vorbild, zaghafte Versuche eines organisierten Widerstands der Benachteiligten erkennbar. Es braut sich etwas zusammen im Land. Wohin das schließlich führen wird, ist freilich bis auf weiteres nicht vorhersagbar. Wer bereits "revolutionäres" Potential zur tiefgreifenden Veränderung unserer Wirtschaft wittert, sollte sich in ruhiger Stunde einmal an die magischen 6 Mio. erinnern, die in den dreißiger Jahren wie ein Damoklesschwert über der ersten Republik hingen. Der Faden ist damals, wie man weiß, gerissen. Die gegenwärtig Situation wird sich in Zukunft aller Voraussicht nach dramatisch verschärfen. So sind Elefantenehen, sprich Firmenzusammenschlüsse, momentan nahezu an der Tagesordnung. Stets bleiben jede Menge Jobs auf der Strecke; im Fall Boehringer (Übernahme durch den Schweizer Pharmakonzern Roche) sollen allein in Mannheim 1.400 Stellen gestrichen werden. Und die Deutsche Bank möchte hierzulande - trotz enormer Profite - in den kommenden drei Jahren die Belegschaft um 5.000 Stellen reduzieren. Sozialverträglich, wie es heißt - was immer man darunter in diesem Zusammenhang auch verstehen mag. Prognosen, wonach die Automobilindustrie von insgesamt 681.000 Arbeitsplätzen mittelfristig weitere 200.000 abbauen will, wurden vom Präsident des Branchenverbands VDA, Bernd Gottschalk, "nicht näher kommentiert". Dementiert hat er sie jedenfalls nicht. Ganz im Gegenteil, Gottschalk wies, obgleich man für 1998 einen inländischen Produktionsrekord erwartet, sogar mehrfach auf den "Zwang zur ständigen Rationalisierung am Standort Deutschland" hin. [1] Das Schlüsselwort Rationalisierung (sprich: Produktivitätsfortschritt) bedarf der näheren Betrachtung. Die Arbeitsproduktivität ist nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in den alten Bundesländern zwischen 1960 und 1996 um 240 % gewachsen. "Waren 1960 noch 56,1 Mrd. Arbeitsstunden notwendig, um ein Bruttoinlandsprodukt (BIP) von einer Billion DM zu erwirtschaften, wurde 1996 mit nur noch 44,4 Mrd. Arbeitsstunden ein BIP von 2,8 Billionen DM produziert (in Preisen von 1991). Mit nur noch 80 % der Arbeitsstunden wurde also ein fast dreifacher realer Produktionswert geschaffen." [2]  Die klassische Antwort hierauf ist das Einfordern von verstärktem Wachstum. Wächst die Wirtschaft stärker als die Produktivität, werden Arbeitsplätze geschaffen. So postuliert es wenigstens die Theorie. Aber Wachstumsraten in diesen Größenordnungen sind in den entwickelten Industriegesellschaften völlig ausgeschlossen (1997 war das Wirtschaftswachstum in Westdeutschland nur halb so hoch wie der Produktivitätsfortschritt). Norbert Reuter verdeutlicht: "Hätte man unter den gegenwärtigen gesamtdeutschen Produtivitätsbedingungen die 1996 durchschnittlich rund 4 Mio. Arbeitslosen in Lohn und Brot bringen wollen, wäre ein zusätzliches BIP von rund 355 Mrd. DM respektive ein Wachstum des BIP 1996 um 12 % nötig gewesen. Geht man realistischerweise von 4,7 Mio. Arbeitslosen aus und legt die höhere westdeutsche Produktivität zugrunde, hätte das BIP sogar um 450 Mrd. DM oder 17 % steigen müssen (in Preisen von 1991)." Aber: "Nur einmal - 1955 - gab es in der BRD ein Wachstum, das mit 12 % gegenüber dem Vorjahr über dieser Marge lag." Und war man sich zudem nicht längst einig darüber, daß solche Wachstumsraten - selbst wenn sie erreichbar wären - unter ökologischen Gesichtspunkten alles andere als wünschenswert sind? Nebenbei bemerkt: Woher ein derartiges Wachstum kommen soll, ist angesichts realer Lohnverluste mehr als schleierhaft. Der Lohn- und Gehaltsindex in Westdeutschland ist nämlich 1997 nur um 1,2 % (Angestellte) bzw. 1,4 % (Arbeiter) gestiegen und lag somit unter der Teuerungsrate von 1,8 %. Das bedeutet den niedrigsten nominalen Zuwachs seit Beginn der statistischen Erfassung im Jahr 1958 (!). Reale Minusrunden bei den Löhnen gehören - insbesondere seit der Wiedervereinigung - aufgrund der verfehlten Politik der Bundesregierung zu dem, was abhängig Beschäftigte fest einkalkulieren müssen. So stieg der Bruttomonatsverdienst vollbeschäftigter Arbeitnehmer in Westdeutschland zwischen 1990 und 1995 um 21,8 %. Netto, nach Abzug von Steuern und Sozialbeiträgen, blieb noch eine Zunahme von 14,9 % übrig. Die Abgabenquote erhöhte sich allerdings von 31 % auf 34,9 %. Da im gleichen Zeitraum eine Teuerungsrate von 16,1 % zu verzeichnen war, sank die Kaufkraft eines Beschäftigten um 1,2 %. Aber ohne Kaufkraft bewegt sich auf dem Binnenmarkt buchstäblich nichts. So hat beispielsweise der deutsche Einzelhandel im vergangenen Jahr nach Einschätzung des Branchenverbands HDE 30.000 Arbeitsplätze abgebaut. Folge der um 1,4 % geschrumpften Umsätze. Der Rückgang der Reallöhne legt sich inzwischen wie Mehltau über die Binnenkonjunktur. Da hilft, wie wir gesehen haben, auch keine Reform des Ladenschlußgesetzes. Wo in aller Welt sind denn die damals vollmundig vorausgesagten 20 Mrd. Mark Umsatzsteigerung und die daraus angeblich resultierenden 50.000 zusätzlichen Arbeitsplätze geblieben? Gerade hier hat sich erneut gezeigt, wie aberwitzig von seiten der Politik und der etablierten Wirtschaftswissenschaft argumentiert wird. Hat man wirklich daran geglaubt, daß sich das Volk - trotz Einkommensverlusten breiter Schichten - in einen Kaufrausch stürzen würde, nur weil die Geschäfte abends länger geöffnet haben? Offensichtlich wurde dabei völlig ignoriert, daß die Menschen nur das ausgeben können, was sie vorher verdienen. Eine ökonomische Binsenweisheit. Oder setzte man blauäugig auf das Verlangen, sich den Warenhäusern zuliebe hemmungslos zu verschulden? Das Niveau des ökonomischen Sachverstands ist im Gegensatz zu früher offenbar erheblich gesunken. Auf welch tönernen Füßen andererseits die Exporterfolge stehen, ist uns mit der Asienkrise deutlich vor Augen geführt worden. Allein mit Hilfe des Exports sind die erforderlichen Wachstumsraten außerdem gar nicht zu erzielen, nach wie vor werden drei Viertel unseres BIP auf dem Binnenmarkt erwirtschaftet. Selbst wenn, wie in der Chemieindustrie, beim Außenhandel kräftig abgesahnt wird (die Nettoumsatzrendite war dort im vergangenen Jahr mit 4,5 % so hoch wie noch nie), hat dies für den Arbeitsmarkt keinerlei positive Auswirkungen (jobless growth). Denn auch im Rekordjahr 1997 (8,5 Mrd. Gewinn, Umsatzsteigerung +7,5 %) sank die Beschäftigung in der Chemie um rund 16.000 Stellen. Höchstens, wir könnten unseren Abnehmern künftig die gleiche Produktqualität zu vietnamesischen Preisen anbieten. BDI-Präsident Hans-Olaf Henkel könnte dem sicherlich einigen Reiz abgewinnen. Es kommt - Kassandra, ick hör' dir tapsen - noch besser: Wissenschaftler der Universität Würzburg prognostizierten nämlich unlängst in einer von der breiten Öffentlichkeit wenig beachteten Studie, daß in der Bundesrepublik im Dienstleistungsbereich in der kommenden Dekade 6,7 Mio. Arbeitsplätze dem Produktivitätsfortschritt zum Opfer fallen. "Die gängige Hoffnung, der Dienstleistungssektor werde die derzeitigen Probleme am Arbeitsmarkt lösen, ist falsch", verkündeten die Forscher. [3] "Das Ergebnis der Studie ist ebenso deprimierend wie eindeutig", resümierte Projektleiter Prof. Dr. Rainer Thome: "Rein rechnerisch können über 40 Prozent der qualifizierten Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich in den nächsten zehn Jahren eingespart werden." [4] Und die Konsequenzen des Euro für den deutschen Arbeitsmarkt sind, so wird im allgemeinen vermutet, ebenfalls eher negativer Natur. 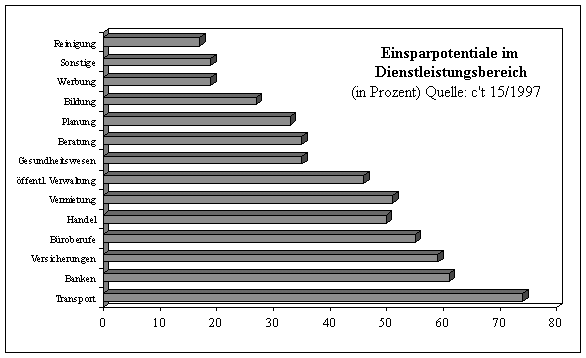 Alles in allem sieht es daher in bezug auf neue Arbeitsplätze recht düster aus. Die neoliberale Wirtschaftspolitik hat sich selbst hilflos in die ökonomische Sackgasse manövriert. Was schließen wir daraus? Erstens: Die Regierung muß weg. Zweitens: Neue wirtschaftspolitische Ansätze (z.B. Ökosteuerreform) müssen endlich in die Praxis umgesetzt werden. Drittens: Das Sozialsystem ist den veränderten Rahmenbedingungen anzupassen (soziale Grundsicherung; Finanzierung über Steuern, anstatt über Beiträge; ein System für alle, Einbeziehung von Beamten und Selbständigen). Viertens: Wir benötigen dringend ein gerechtes Steuersystem, das den gewünschten sozialen Ausgleich herstellt und nachhaltig die Steuerbasis der öffentlichen Haushalte sichert. Fünftens: Die internationalen Finanztransfers sind stärker zu kontrollieren und Spekulanten zu bändigen (z.B. durch Tobin-Tax). Sechstens: Wir brauchen weitere Arbeitszeitverkürzungen und eine einschneidende Reduzierung der Überstunden. Siebtens: Die Einkommen sind von der alleinigen Fixierung auf die Erwerbsarbeit abzukoppeln und sollten durch breite Streuung des Produktivkapitals ergänzt werden. Achtens: Wir brauchen mehr GRÜNE im Bundestag. Stichwort: Tobin-Tax Nach dem Jahresbericht 1996 der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) wurden an einem durchschnittlichen Tag an den Welt-Devisenmärkten Umsätze in Höhe von 1.250 Mrd. US-Dollar getätigt. Und die derivaten Fianzinstrumente (Zinsfutures, Währungsoptionen, Zins- und Währungsswaps etc.) erreichten 1994 einen Wert von 17.312 Mrd. US-Dollar. Offensichtlich sind in den letzten Jahren weniger die Handelsströme (also realwirtschaftliche Daten), sondern vielmehr die zins- und spekulationsbedingten internationalen Kapitalbewegungen für die Kursentwicklung der Währungen ausschlaggebend geworden. Nicht zuletzt die Asienkrise hat das noch einmal deutlich gemacht. Folge davon ist eine Destabilisierung der Wechselkurse, mit entsprechend negativen Konsequenzen für die Weltwirtschaft. So haben z.B. Währungs- und Aktienkursverluste in ganz Asien praktisch über Nacht ein zusätzliches Millionenheer von Armen produziert. In Indonesien gibt es deshalb bereits Hungerrevolten. Und wie man an Japan sieht, können auch entwickelte Industrienationen in den Sog des Abwärtsstrudels hineingerissen werden. James Tobin (geb. 1918, amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, Nobelpreis 1981) entwickelte eine Gegenstrategie. Er richtete sein Augenmerk auf grenzüberschreitende Spekulationsgeschäfte, die solche Wechselkursschwankungen auslösen. Tobin empfahl eine globale Devisentransaktionssteuer - die Tobin-Tax. Ein Steuersatz von 0,5 % könnte zu jährlichen Steuereinnahmen von bis zu 450 Mrd. US-Dollar führen und die kurzfristigen Finanztransfers (68 % aller Devisentransaktionen haben eine Anlagedauer von weniger als 8 Tagen) reduzieren. ---------- [1] Frankfurter Rundschau v. 30.01.1998 [2] Norbert Reuter, Rheinisch-Westfälische Hochschule Aachen, Frankfurter Rundschau v. 29.12.1997 [3] Frankfurter Rundschau v. 12.06.1997 [4] c't 15/1997 |
