
| Home | Archiv
| Impressum 30. November 2002, von Michael Schöfer Erosion der Staatsfinanzen selbst verschuldet Die Staatsfinanzen sind, wie die hektischen Sparbemühungen von Bund und Länder belegen, längst aus dem Ruder gelaufen. An dieser Misere ist der Staat freilich nicht ganz schuldlos, hat er doch die Notlage mit einer - meiner Meinung nach - verfehlten Wirtschaftspolitik selbst herbeigeführt. Volkswirtschaftlich betrachtet geht es uns immer noch recht gut, und mit dem Drehen an den richtigen Stellschrauben ließe sich die Situation gewiß bereinigen. Gegenwärtig dreht man allerdings an den falschen Stellschrauben, so sollen die öffentlichen Haushalte abermals vor allem zu Lasten der Arbeitnehmer und der Erwerbslosen saniert werden. Eine Politik, die wir seit Beginn der achtziger Jahre registrieren müssen, ohne daß sie uns irgendwie weitergeholfen hätte (Rot-Grün handelt hier übrigens nicht anders als Schwarz-Gelb). Im Gegenteil, wie die Lage auf dem Arbeitsmarkt und die Löcher in den Sozialkassen beweisen, führt dieser Kurs zielstrebig in die falsche Richtung und ist insofern geradezu kontraproduktiv. Man muß vielmehr befürchten, daß wir uns damit seit langem in einer ökonomischen Abwärtsspirale befinden, aus der wir uns immer schwerer befreien können. Es ist Zeit umzusteuern. Wirtschaftswachstum Das Bruttoinlandsprodukt (BIP), das Ergebnis aller im Inland erstellten Waren und Dienstleistungen, ist in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung der wichtigste Gradmesser für den gesellschaftlichen Wohlstand. Das um die Inflationsrate bereinigte reale BIP weist aus, daß dieser Wohlstand in der Bundesrepublik seit 1991 um 15,7 Prozent gewachsen ist - eine im Grunde keineswegs schlechte Bilanz. Im Jahr 2001 erwirtschafteten wir sogar das höchste Sozialprodukt, das hierzulande jemals verzeichnet wurde. Paradoxerweise wird jedoch allenthalben über leere Kassen geklagt. Das ist einerseits auf die Propaganda der Lobbyisten zurückzuführen, die - unabhängig von der tatsächlichen Lage - jegliche Veränderung zu Ungunsten ihrer Urheber schon im Vorfeld abwehren soll. Die Unternehmerverbände etwa beklagen sich pausenlos über die, wie sie behaupten, viel zu hohe Steuerlast und den angeblich unbezahlbaren Sozialstaat. In einer Demokratie, in der die öffentliche Diskussion die Richtung der Politik maßgeblich beeinflußt, ist das absolut normal und völlig legitim. Die Fakten dokumentieren indes etwas anderes. Andererseits ist dies aber auch das Resultat einer jahrelangen gnadenlosen Umverteilungspolitik, denn mit dem ständigen Wiederkäuen des altbekannten neoliberalen Einheitsbreis haben die Unternehmerverbände bei der Politik über alle Parteigrenzen hinweg Gehör gefunden. Unterstützt von Mainstream der Wirtschaftswissenschaft empfahl man uns die Nichteinmischung des Staates in das Wirtschaftsgeschehen unermüdlich als der Weisheit letzter Schluß. Gemessen an den konkreten Ergebnissen wider besseren Wissens. So ist das Arbeitslosenheer zwischen 1991 und 2001 im Jahresdurchschnitt von 2,60 Mio. auf 3,85 Mio. angewachsen, was einer Steigerung der Arbeitslosenquote von 7,3 auf 10,3 Prozent entspricht. [1] 1,25 Mio. mehr Arbeitslose trotz 15,7 Prozent Wirtschaftswachstum. Eine unbestreitbar katastrophale Ausbeute, aber offenbar nach wie vor kein Anlaß, die ökonomische Wende einzuleiten. Eisern hält man an dem einmal eingeschlagenen Kurs fest. Glaubt man der Deutschen Bundesbank, kann der negative Trend auf dem Arbeitsmarkt erst ab 2,25 Prozent jährlichem Wirtschaftswachstum gestoppt werden. [2] Viele Ökonomen empfehlen deshalb zum Abbau der Arbeitslosigkeit eine Wachstumsrate von mindestens drei Prozent. Um die Arbeitslosenrate bis 2005 zu halbieren, ist, dem renommierten Prognos-Institut zufolge, pro Jahr ein zusätzliches Wachstum von 3,7 Prozent erforderlich. [3] Ein Ausmaß, das wir seit der Wiedervereinigung als Einzelergebnis nur im vereinigungsbedingten Boomjahr 1991 erreicht haben - und seitdem nie wieder. Dieses Ziel ist aus zwei Gründen unrealistisch. Erstens: Die Lehre vom abnehmenden Grenznutzen besagt, daß bei steigendem Wachstum die jährliche Wachstumsrate tendenziell immer geringer ausfällt. Das BIP sammelt sich ja nicht an, sondern muß in jedem Jahr erneut zur Gänze erwirtschaftet werden. Soll es pro Jahr um 3 Prozent wachsen, beträgt die Erhöhung bei einer angenommenen Ausgangsbasis von 1.000 Mrd. Euro im ersten Jahr 30 Mrd. Euro. Eine konstante Wachstumsrate von 3 Prozent unterstellt, hat sich das BIP nach 24 Jahren mehr als verdoppelt und hat dann eine Höhe von 2.033 Mrd. Euro erreicht. Die 30 Mrd. Euro des ersten Jahres würden das BIP im 25. Jahr allerdings nur noch um 1,5 Prozent anheben. Um die gleiche prozentuale Wachstumsrate zu erzielen, wäre im 25. Jahr ein Betrag von 61 Mrd. nötig - mehr als das Doppelte der ursprünglichen Summe. Will man die konstante Wachstumsrate halten, ist daher (in absoluten Beträgen) eine immer größere Anstrengung erforderlich. Und gerade das Gelingen dieser Anstrengung wird hierdurch von Jahr zu Jahr unwahrscheinlicher. Es ist, als ob man im Treppenhaus bei jeder Treppenstufe ein zusätzliches Gewicht zugesteckt bekommt, irgendwann wird man an einer einzelnen Stufe scheitern. Es sei denn, man hat die Möglichkeit, die Treppenstufen dem steigenden Gewicht anzupassen, sprich zu verkleinern. Und genau das passiert auch beim Wirtschaftswachstum. Zweitens: Woher sollen im konkreten Fall die Wachstumsimpulse kommen? Wie weiter unten detailliert aufgezeigt wird, ist der Anteil der Arbeitnehmer am gesellschaftlichen Wohlstand kontinuierlich gesunken. Demzufolge fällt die Massenkaufkraft (Nachfrage) auf dem Binnenmarkt als Impuls für das Wirtschaftswachstum weitgehend aus. Bleibt der Export. Dieser ist zwar deutlich angewachsen, freilich sind wir hier auch verstärkt den wechselhaften Launen des Weltmarkts ausgeliefert, auf den nationale Politik kaum noch einwirken kann. Immer nur auf das Anziehen der Konjunktur in den Vereinigten Staaten zu vertrauen, ist keine konstruktive Wirtschaftspolitik. Es erscheint vielmehr, unter Berücksichtigung der nicht gerade vielversprechenden volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen der US-Wirtschaft (extrem hohe Auslandsschuld; immense Defizite der öffentlichen Haushalte; enorme Verschuldung der Unternehmen und der Verbraucher; unaufhörlich zunehmende Außenhandelsdefizite), eher wie das Hoffen auf ein ökonomisches Wunder. In unserem Wirtschaftssystem läuft etwas grundsätzlich verkehrt, wenn wir trotz niedrigen Wachstumsraten relativ schnell in die Krise geraten. Das BIP erhöht sich ja nach wie vor, offensichtlich bloß nicht in dem zum Abbau der Arbeitslosigkeit notwendigen Ausmaß. Den Anstieg der Produktivität [4], im vergangenen Jahr 1,4 Prozent [5], wußte man früher mit Arbeitszeitverkürzung zu kompensieren. Doch hier hat sich seit Mitte der neunziger Jahre nichts mehr bewegt. Wenn allerdings die Produktivität bei gleichbleibender Arbeitszeit über dem BIP-Wachstum liegt, werden logischerweise Arbeitskräfte überflüssig. Da anhaltend hohe Wachstumsraten über dem Produktivitätsfortschritt jedoch illusorisch sind, bleibt eigentlich kein anderer Ausweg, als die Arbeitszeit nach unten anzupassen. Davon abgesehen gibt es seit langem ernsthafte ökologische Bedenken gegen einen Kurs, der sich fast ausschließlich auf hohe Wachstumsraten stützt. 1972 erschien der erste Bericht an den "Club of Rome" ("Die Grenzen des Wachstums"), und 1977 gab der damalige US-Präsident, Jimmy Carter, mit einer Direktive den Startschuß zu einer dreijährigen Ermittlung der langfristigen Folgen der Entwicklungstrends auf den Gebieten der Bevölkerung, der natürlichen Ressourcen und der Umwelt ("Global 2000"). Ausfluß dieser beiden grundlegenden Arbeiten war die Erkenntnis, daß es in einer endlichen Welt kein unendliches Wachstum geben kann. Zwischenzeitlich hat sich zwar einiges getan, so ist etwa in Deutschland der Ausstoß von CO2 zwischen 1990 und 2000 um 15,4 Prozent gesunken. [6] Insofern hat sich die Belastung mit Umweltschadstoffen in der Tat, wie von Ökologen postuliert (qualitatives Wachstum), vom Wirtschaftswachstum entkoppelt. Ob wir damit wirklich auf dem richtigen Weg sind, darf allerdings bezweifelt werden. Der Rückgang der CO2-Emissionen ist nämlich hauptsächlich auf den Niedergang der ineffizienten DDR-Industrie und demzufolge weniger auf eine echte Umgestaltung zurückzuführen. Der Einsatz der stark kohlenstoffhaltigen Braunkohle hat sich dort erheblich reduziert, weshalb der CO2-Anteil der Braunkohle an den Gesamtemissionen in den neunziger Jahren nahezu halbiert wurde (von 343,2 Mio. t im Jahr 1990 auf 173,6 Mio. t im Jahr 2000). [7] In den alten Bundesländern fiel die CO2-Reduktion wesentlich geringer aus. Die deutsche Einheit, auch diesbezüglich ein Glücksfall. Deshalb ist es äußerst fragwürdig, wenn sich die Bundesregierung nun mit einer - bezogen auf das Jahr 1990 - 15prozentigen Reduzierung der CO2-Emissionen brüstet. Die Selbstverpflichtung des Kabinetts Kohl vom 7. November 1990, die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2005 um 25 bis 30 Prozent zu reduzieren, bezog sich bekanntlich allein auf Westdeutschland. Die Prognosen für das Jahr 2020 sagen uns, je nach Wirtschaftsentwicklung, allenfalls eine Stagnation der CO2-Emissionen voraus (weltweit steigen sie sowieso schier unaufhaltsam an). Bei einem aus ökonomischer Sicht wünschenswerten durchschnittlichen Wirtschaftswachstum von 3 Prozent würden sie wohl auch hierzulande wieder ansteigen. Unser Grundproblem bleibt: Ein Wirtschaftssystem, das hohe Wachstumsraten braucht, um die sozialen Probleme einigermaßen in den Griff zu bekommen, dabei aber massiv die Umwelt schädigt, ist letztlich widersinnig. Daß es auch anders geht, zeigen u.a. die Studien des Club of Rome. [8]
 
 Exportweltmeister Die hohe Arbeitslosigkeit resultiert, entgegen den immer wiederkehren Beteuerungen der Unternehmerverbände, nicht aus der mangelnden Konkurrenzfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft. Auf dem Weltmarkt sind wir der Konkurrenz nach wie vor gewachsen. So exportierten wir im Jahr 2001 Waren im Wert von 570 Mrd. US-Dollar und lagen damit zwar 160 Mrd. US-Dollar hinter der wesentlich größeren amerikanischen Volkswirtschaft zurück, aber noch 167 Mrd. US-Dollar vor Japan. Berücksichtigt man die Einwohnerzahl, sind wir sogar Exportweltmeister: Pro Kopf erwirtschafteten wir beim Export 7 Mrd. US-Dollar, Japan 3,2 Mrd. und die USA lediglich 2,6 Mrd. [11] Auf den geringen Erfolg unserer Volkswirtschaft im Ausland ist die angespannte Lage der heimischen Wirtschaft also nicht zurückzuführen. Es liegt vielmehr an der äußerst beklagenswerten binnenwirtschaftlichen Umverteilung der hohen Exportüberschüsse. Während der Außenhandel einen immer höheren Anteil am Bruttoinlandsprodukt einnimmt, fehlt auf dem Binnenmarkt - mangels Umverteilung - die notwendige Kaufkraft, um die Wirtschaft nachhaltig anzukurbeln. Die Arbeitnehmer erzielen nämlich seit Jahren nur noch einen permanent zurückgehenden Anteil am gesellschaftlichen Wohlstand. Der frühere SPD-Vorsitzende, Oskar Lafontaine, der schon 1990 - wie sich nachträglich herausgestellte - die besseren ökonomischen Konzepte in bezug auf die deutsche Wiedervereinigung vorlegte, damit aber als Kanzlerkandidat gescheitert ist, brachte es auf den Punkt: "Der Export allein reicht nicht. Seit Jahren stagnieren die Netto-Reallöhne der Arbeitnehmer. Die Folge ist eine ausgeprägte Schwäche der inländischen Nachfrage. (...) Wir müssen den deutschen Binnenmarkt wieder in Schwung bringen. Deshalb brauchen wir eine vernünftige Lohnpolitik, die den Arbeitnehmern einen fairen Anteil am gemeinsam erarbeiteten Wohlstand sichert", schrieb er 1997 in einem Grundsatzpapier. [12] Seine eindringliche Warnung, Deutschland müsse sich von der ungesunden Exportorientierung lösen und - durch Stärkung der Kaufkraft - den eigenen Binnenmarkt festigen, blieb allerdings ohne Wirkung. Der Anteil des Exports am BIP ist in den neunziger Jahren erheblich angewachsen, von 22,7 Prozent im Jahr 1991 auf 30,9 Prozent im Jahr 2001. Allein seit 1991 sind die Sozialabgaben um 6 Prozentpunkte gestiegen (eine Erhöhung um 17 Prozent), gegenwärtig liegen sie bei 41,3 Prozent. Im Jahr 1998 erreichten sie unter Helmut Kohl mit 42,14 Prozent ihr bisheriges Rekordniveau, ein Hauptgrund für dessen Amtsverlust. Die rot-grüne Bundesregierung unternahm zwar den Versuch, die Sozialabgaben mit einer Rentenreform (dazu später mehr) und der Ökosteuer wieder auf ein erträglicheres Maß zu reduzieren, dies gelang aber nur vorübergehend. Bereits im kommenden Jahr (2003) werden sie wieder auf über 42 Prozent anwachsen. Zusammen mit der Lohnsteuer (dazu später mehr) sind die hohen Sozialabgaben für die Reallohnverluste der Arbeitnehmer verantwortlich. Der Anteil der Nettolöhne und -gehälter am verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte ist zwischen 1991 und 2001 von 49,6 Prozent auf 43,8 Prozent gesunken, während die Vermögenseinkommen von 27,9 Prozent auf 30,4 Prozent angewachsen sind. Heute verfügt ein Beschäftigter nach Abzug der Lohnsteuer und der Sozialabgaben nur noch über 65,4 Prozent seines Bruttolohns - 4,1 Prozentpunkte weniger als 10 Jahre zuvor. Berücksichtigt man die Inflationsrate, sind die Nettolöhne seitdem um 2,1 Prozent gesunken. Mit den entsprechenden Folgen für den Konsum. Natürlich sind das nur Durchschnittswerte, sie sagen nichts über die tatsächliche Verteilung der Einkommen. So bestehen starke sektorale und regionale Unterschiede. Nach Angaben des "Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung" (WSI) verfügen die Selbständigen momentan über 290 Prozent des durchschnittlichen Einkommens aller privaten Haushalte, 1993 lagen sie noch bei 254 Prozent (ein Plus von 36 Prozentpunkten). Geschrumpft ist die Position der Arbeiter (von 95 auf 90,5 Prozent), der Arbeitslosen (von 65,4 auf 58,5 Prozent) und der Sozialhilfeempfänger (von 43,2 auf 40,4 Prozent). Letztere lagen damit weit unter der offiziellen Armutsgrenze. Die Position von Beamten (140 Prozent) und Rentnern (67 Prozent) ist dagegen nahezu gleich geblieben. [13]

 
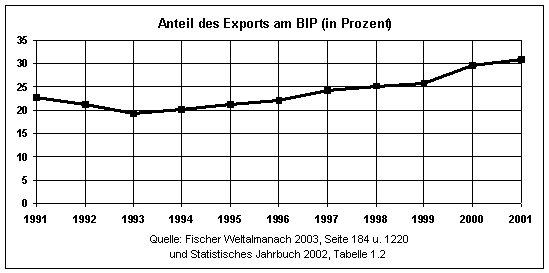


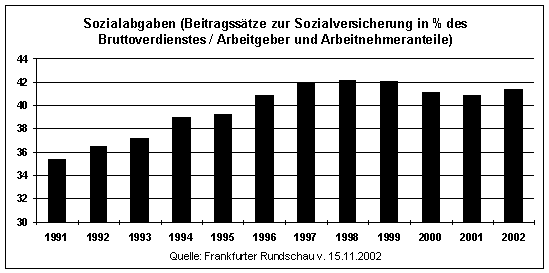
 Lohnsteuerstaat Die Bundesrepublik ist ein Lohnsteuerstaat bzw. sie hat sich sukzessive dahin entwickelt. Wie die nachfolgenden Tabellen [22] zeigen, ist der Anteil der von den Arbeitnehmern und Konsumenten zu entrichteten Steuerarten (Lohnsteuer, Umsatzsteuer) in den vergangenen dreißig Jahren erheblich angewachsen - im Gegensatz zu den von den Unternehmen zu entrichteten Steuerarten (Veranlagte Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer), die in der zurückliegenden Dekade alle dramatisch eingebrochen sind. Bei der Körperschaftsteuer kam es im Jahr 2001 durch Verrechnungsgewinne [23] sogar zu einer Rückerstattung der Finanzämter an die Unternehmen, d.h. sie erhalten mehr von Staat zurück als sie zahlen. Hätten die Arbeitnehmer und Konsumenten gegenwärtig noch den gleichen Anteil am Steueraufkommen wie zu Beginn der siebziger Jahre, müßten sie 57,8 Mrd. Euro weniger Steuern zahlen, die Unternehmen hätten hingegen eine um 70,6 Mrd. Euro höhere Belastung zu tragen. Natürlich ist der Steuermix von 1970 endgültig passé, diesbezüglich sollte man sich keinen Illusionen hingeben. Aber diese fiktive Fortschreibung zeigt, wohin seitdem die Reise gegangen ist: Zur konsequenten, der Angebotsphilosophie konformen Entlastung der Unternehmen. (Angebotsorientierung = verbesserte Produktionsbedingungen durch Steuer- und Abgabenentlastung der Unternehmen. Dies soll zu einem preislich günstigeren Warenangebot und/oder zu einer besseren Rentabilität führen, was wiederum, zumindest der Theorie zufolge, die Investitionen begünstigt. Aus dem erhöhten Investitionsbedarf entstehen dann, wenigstens hypothetisch, mehr Arbeitsplätze.) Es ist kein Geheimnis, daß diese Wirtschaftspolitik gründlich gescheitert ist. Die Arbeitslosenzahlen beweisen es. Kostensenkungsprogramme allein generieren einfach nicht die zum Abbau der Arbeitslosigkeit notwendigen Wachstumsraten, weil dann auch - entgegen der theoretischen Annahme - die für den Absatz der Produkte unerläßliche Kaufkraft sinkt. Löhne sind eben nicht nur Kosten, sondern auch Absatzpotential. Es ist eine Legende, daß sich die Angebotsseite quasi aus dem Nichts heraus ihr Nachfragepotential selbst erschafft. Reallohnverluste mögen die Angebotsseite stärken, aber sie schwächen in gleichem Maße die Nachfrageseite. Die Katze beißt sich also in den Schwanz. Folge von alledem ist, wie unter anderem die schwindenden Umsätze der konsumnahen Bereiche (etwa die des Einzelhandels) belegen, eine tiefgreifende Nachfragekrise. Unter diesen Rahmenbedingungen wird natürlich auch nicht ausreichend investiert. So sanken, gemessen am Anteil des Bruttoinlandsprodukts, die Anlageinvestitionen des produzierenden Gewerbes seit 1970 um 2,9 Prozentpunkte. Daran hat auch die Wiedervereinigung nichts geändert, obgleich hier eigentlich hoher Investitionsbedarf vorhanden wäre. Die Steuerentlastungen der Unternehmen sind somit, zumindest was die Investitionen angeht, wirkungslos verpufft. Das Steueraufkommen als Ganzes ist, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, über die Jahre hinweg in etwa gleich geblieben und hat sich bei knapp über 20 Prozent eingependelt. Die Steuerbelastung ist, volkswirtschaftlich betrachtet, sogar leicht zurückgegangen. Was man jedoch im Gegensatz dazu vollzog, war eine gewaltige steuerliche Belastung der Arbeitnehmer und eine beträchtliche Entlastung der Unternehmen. Es ist evident, daß die öffentlichen Haushalte hierdurch bei anhaltend hoher Arbeitslosigkeit ins Trudeln geraten. Die Verteilungsfrage wird im allgemeinen als anachronistisch bezeichnet, gleichwohl hat eine drastische Umverteilung des gesellschaftlichen Wohlstands stattgefunden. Innerhalb des Steueraufkommens muß endlich wieder eine Verschiebung zu Gunsten der unteren und mittleren Einkommen erfolgen, anders läßt sich die notwendige Kaufkraft zur Stärkung des Binnenmarkts nicht zustande bringen. Um es klar zu sagen: Dies ist, vielleicht mit Ausnahme in bezug auf die Wiedereinführung der Vermögensteuer, kein Plädoyer für eine Erhöhung des Steueraufkommens, sondern vielmehr ein Plädoyer für eine gerechtere Umverteilung desselben. Denn, wie wir gesehen haben, der Lohn- und Umsatzsteueranteil ist mittlerweile viel zu hoch, der Anteil der Unternehmenssteuern dagegen viel zu niedrig. Warum die Unternehmerverbände mit ihrem Sermon von den angeblich viel zu hohen Unternehmenssteuern in der Öffentlichkeit nicht auf blankes Unverständnis stoßen, ist angesichts der Faktenlage völlig schleierhaft. In einer Zeit, in der die Unternehmen kaum noch Steuern zahlen, müßten sie sich mit ihrem Bestreben nach weiteren Steuersenkungen eigentlich der Lächerlichkeit preisgeben.
Veranlagte Einkommensteuer = wird vorrangig von Gewerbetreibenden und Freiberuflern entrichtet Gewerbesteuer = Steuer für im Inland ansässige Gewerbebetriebe
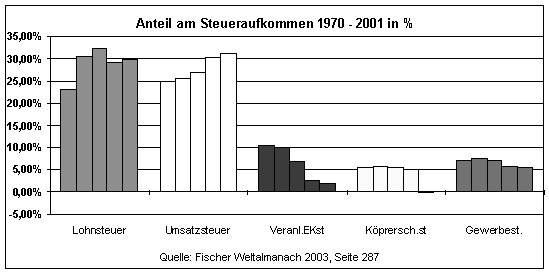  
 Steuerreform Die Steuerreform der Bundesregierung ist von ihrer Struktur her als verfehlt zu bezeichnen. Den Spitzensteuersatz um 0,1 Prozent mehr zurückzunehmen als den Eingangssteuersatz [25], ist wahrlich keine "Wiederherstellung der Steuergerechtigkeit". [26] Daraus folgt unweigerlich, daß die höheren Einkommen in absoluten Zahlen überproportional entlastet werden. Zudem profitieren dort Ledige deutlich mehr als Verheiratete oder Alleinstehende mit Kindern (vgl. Entlastungstabelle). [27] Müssen, so darf man berechtigterweise fragen, Spitzeneinkommen wirklich eine zehn- oder zwanzigmal höhere Entlastung erfahren als Durchschnittseinkommen? Muß ein Lediger mit 150.000 DM Jahreseinkommen wirklich eine höhere Entlastung bekommen als ein Verheirateter mit zwei Kindern? Familienförderung ist das, entgegen den Bekundungen in den Sonntagsreden der Politiker, nicht. Auch das Ehegattensplitting ist eine massive Fehlleitung von Fördermitteln. Die Aufgabe der steuerlichen Bezuschussung des Verheiratetseins würde rund 23 Mrd. Euro freisetzen, die man zu Gunsten der Menschen mit Kindern umschichten könnte. [28] Die Spitzeneinkommen hätten durchaus eine weniger ausgeprägte Entlastung hinnehmen können. Die Konsumquote liegt bekanntlich bei Durchschnitts- und Niedrigverdienern sehr viel höher als bei den Besserverdienenden, denn letztere haben nach der Deckung ihrer Grundbedürfnisse mehr zur freien Verfügung. Doch die, die viel haben, können gar nicht entsprechend mehr konsumieren. Die, die wenig haben, würden gerne mehr konsumieren, können es aber nicht, weil es das vergleichsweise geringe Einkommen nicht zuläßt. Gerade hier wären finanzielle Entlastungen also auf fruchtbaren Boden gefallen und hätten die Kaufkraft auf dem Binnenmarkt enorm gestärkt. Im Grunde geht es also doch um die klassische Verteilungsfrage.
Rentenreform Die rot-grüne Bundesregierung hat mit der neuen Rentengesetzgebung den Rentenbezug des sogenannten Standardrentners trickreich auf 67,85 Prozent festgelegt (nach alter Berechnungsgrundlage - also ohne Trick - wären das 64,32 Prozent). Ein Vorhaben, das die heutigen Regierungsparteien beim früheren Bundesarbeitsminister, Norbert Blüm (CDU), der seinerzeit ein ähnliches Modell vorlegte (Einführung eines demographischen Faktors und Kürzung der Rente auf 64 Prozent), noch heftig kritisierten und als "sozialen Kahlschlag" gebrandmarkt haben. Allerdings war das vor dem Regierungswechsel. So schnell ändern sich manchmal die Verhältnisse. Hinzu kam bei Rot-Grün die früher ebenfalls hart bekämpfte partielle Abkehr vom Umlageverfahren und damit einhergehend von der paritätischen, durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu gleichen Teilen beglichenen Beitragsfinanzierung. Ergebnis ist der Einstieg in das vormals verpönte private Kapitaldeckungsverfahren, an dessen Finanzierung die Arbeitgeber keinen Anteil mehr haben. [29] In Zukunft werden die Arbeitnehmer, unterstützt durch eine staatliche Förderung, mehr Beiträge zu zahlen haben als die Arbeitgeber. Ohne diese Reform hätte der Beitragssatz den Prognosen zufolge im Jahr 2030 bei ungefähr 23,9 Prozent gelegen, wovon Arbeitgeber und Arbeitnehmer jeweils 12 Prozent getragen hätten. [30] Mit der jetzigen Rentenreform wird der Beitragssatz im Jahr 2030 auf 22 Prozent festgeschrieben, davon tragen dann die Arbeitgeber 11 Prozent, die Arbeitnehmer hingegen 15 Prozent (11 Prozent gesetzliche Rentenversicherung plus 4 Prozent private "Riester-Rente"). Mit anderen Worten: Die "Riester-Rente" bewirkt für die Arbeitgeber gegenüber dem alten Modell eine Reduzierung um 1 Prozent, für die Arbeitnehmer bringt sie jedoch eine Erhöhung um 3 Prozent. Ob der Beitragssatz damit bis zum Jahr 2030 wirklich auf dem Niveau von 22 Prozent stabilisiert werden kann, steht allerdings in den Sternen, da die hierbei unterstellte Entwicklung des Wirtschaftswachstums und daraus resultierend die des Arbeitsmarkts schlechterdings kaum seriös vorhersagbar sind. Die aktuelle Entwicklung der Beitragssätze bei der Rentenversicherung deutet darauf hin, daß man sich nicht unerheblich verrechnet hat. Die ursprünglich für das nächste Jahr prognostizierten 18,7 Prozent sind bereits jetzt, rund ein Jahr nach Inkraftsetzung der Reform, Makulatur. Nach den Plänen des Sozialministeriums soll der Rentenbeitrag 2003 auf mindestens 19,5 Prozent steigen. Die Belastung steigt also, trotz Riester-Rente, wieder an. Die Riester-Rente wird zudem in der Ansparphase die Kaufkraft, und damit die effektive Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen, weiter schmälern. Sie lenkt nämlich in nicht unerheblichem Ausmaß Kapital von den Konsum- zu den Anlagemärkten (ab dem Jahr 2008 4 Prozent der Bruttolöhne). Ob es da einerseits produktiv (z.B. für Investitionen) angelegt wird und andererseits entsprechend sicher ist, darf bezweifelt werden. Die Beiträge zur Riester-Rente liegen ja nicht irgendwo im Tresor herum und harren der Auszahlung. Geld muß erfahrungsgemäß arbeiten. Ob die Unternehmen jedoch bei weiterhin absehbarer Nachfrageschwäche (durch stagnierende oder sinkende Reallöhne) zum Investieren geneigt sind, muß man skeptisch beurteilen. An einer Kapitalschwäche leiden wir ja bekanntlich nicht, es ist bloß in den falschen Händen (dazu später mehr). Die Anlagemärkte werden also in Zukunft mit immensen Guthaben, die nach sinnvollen - sprich rentablen - Investitionen lechzen, überschwemmt. Es steht deshalb zu befürchten, daß sie sich dabei abermals von der realen Wirtschaft entfernen und verstärkt der riskanten Spekulation anheimfallen. Das Jammern wird groß sein, wenn sich erst einige Banken oder Versicherungen mächtig verspekulieren und dabei in die Insolvenz getrieben werden. In diesem Fall bleibt nur noch, wie in Japan bereits mehrfach vorexerziert, der Staat als letzter Rettungsanker. Dem Finanzsystem droht dort nämlich aufgrund allzu leichtfertig vergebener Kredite der Kollaps. Nachdem einige Banken zusammenbrachen und hierdurch die in einem Kapitaldeckungsverfahren angesammelten Rentenrückstellungen vieler Japaner gefährdet waren, mußte die Regierung notgedrungen als Garant auftreten. Andernfalls wäre eine erkleckliche Anzahl der Japaner im Alter vor dem absoluten Nichts gestanden. Nebenbei bemerkt: Die Kapitalrendite der japanischen Pensionsfonds tendiert dort momentan, dank der Krise des Finanzsektors, gegen Null. Hier werden zur Zeit also viele Erwartungen bitter enttäuscht. Die Baisse an den Anlagemärkten zwingt die deutschen Versicherungsunternehmen bereits jetzt, die Überschußbeteiligungen nach unten zu korrigieren. Und mit der Gründung einer Auffanggesellschaft haben sie dokumentiert, daß sie auch hierzulande durchaus mit Insolvenzen rechnen. "Wer die Systeme tauscht, tauscht nur die jeweiligen Risiken. (...) Deutschland hat in den vergangenen 80 Jahren zweimal eine fast vollständige Vernichtung aller Geldvermögen erlebt. Natürlich hoffen wir alle, dass Krieg, Inflation und Börsencrash in Zukunft nicht wieder vorkommen. Aber die Geschichte ist auch international reich an Beispielen dafür, dass man mit Kapitalanlagen viel gewinnen, aber auch sehr schnell viel verlieren kann: Die Asienkrise, die Russlandkrise und die Schwierigkeiten in Lateinamerika sind die jüngsten Beispiele." [31] Dies zeigt, welche Risiken ein Kapitaldeckungsverfahren beinhalten kann. Wer außerdem meint, ein solches wäre vor den Gefahren, die uns durch die negative Entwicklung des demographischen Aufbaus der Bevölkerung drohen, gefeit, irrt gewaltig. Auch Banken und Versicherungen müssen sich auf die zunehmende Vergreisung der Gesellschaft einstellen: "Die jeweils erwerbstätige Generation [muß] stets zugunsten der Rentner auf Teile des gesamtwirtschaftlich verfügbaren Gütervolumens verzichten, und zwar unabhängig vom Finanzierungsverfahren." [32] "Der Alterungsprozess der Bevölkerung betrifft [somit] nicht nur die Umlagefinanzierung, sondern auch die Kapitalfundierung. (...) Wenn einem steigenden Anteil Älterer ("Babyboomer"), die ihren Lebensabend aus kapitalfundierten Systemen bestreiten wollen, eine zahlenmäßig immer kleinere nachwachsende Generation als Sparer und Käufer von Vermögenstiteln gegenübersteht, so hat dies Konsequenzen für den Realwert der angesammelten Vermögen." [33] Die mit Immobilien abgesicherten Vermögenswerte dürften beispielsweise bei drastisch abnehmender Bevölkerung gezwungenermaßen an Wert verlieren (die Zahl der Konsumenten wird den Prognosen zufolge bis 2050 um zirka 28 Prozent abnehmen). [34] Die bei einem Umlageverfahren eigentlich notwendigen Beitragserhöhungen respektive Leistungskürzungen werden bei einem Kapitaldeckungsverfahren also lediglich durch marktkonforme Anpassungen der Vermögenswerte abgelöst. "Bei steigender Rentnerzahl ist eine Teilauflösung erforderlich, die das Kapitalmarktangebot erhöht und den Wert des Fonds möglicherweise stark reduziert. Setzt ein größerer Entsparprozeß ein, steigt zudem die Konsumgüternachfrage an. Bei Vollbeschäftigung ergeben sich Preissteigerungen, d.h. die Erwerbstätigen werden zu einem realen Konsumverzicht über höhere Preise statt über höhere Beiträge gezwungen. Auch trägt der Inflationsprozeß zu einer weiteren Entwertung des Kapitalstocks bei. Der Übergang zum Kapitaldeckungsverfahren stellt also schon aufgrund der damit verbundenen gesamtwirtschaftlichen Risiken keine Lösung der demographisch bedingten Probleme dar und erhöht letztlich auch nicht die ökonomische Sicherheit zukünftiger Rentnergenerationen." [35] Worin am Ende, außer in der Entlastungswirkung für die Unternehmer, die Vorteile des Kapitaldeckungsverfahren gegenüber dem Umlageverfahren liegen sollen, ist angesichts dessen völlig schleierhaft. Ferner: "Die gesetzliche Rentenversicherung sichert (...) nicht nur das Einkommensrisiko im Alter ab - sie gewährt sozialen Schutz bei Invalidität und im Hinterbliebenenfall. Sie trägt den hälftigen Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag und gewährt Rehabilitationsleistungen. Zeiten der Arbeitslosigkeit und Krankheit, der Kindererziehung und der ehrenamtlichen Pflege finden im Gegensatz zur Privatversicherung rentenrechtlich Anerkennung. Der soziale Schutz der Rentenversicherung ist zudem weitgehend unabhängig vom Ausmaß des individuellen Risikos - also etwa dem Geschlecht, dem Eintrittsalter in die Versicherung, eventuellen Vorerkrankungen oder der Zahl der Familienmitglieder bzw. dem Familienstand. (...) Vor allem das Risiko einer frühzeitigen Erwerbsunfähigkeit wird unabhängig von Vorerkrankungen oder vom Alter in einem Umfang abgesichert, den zu diesen Konditionen keine Privatversicherung anbieten könnte. Denn Privatvorsorge kennt nicht nur keine Parität bei der Finanzierung, sondern auch keinen Solidarausgleich bei den Leistungen. Deshalb zählt auch das Solidarprinzip zu den Verlierern der Rentenreform 2000." [36] Die andere Alternative, die Verbreiterung der Beitragsbasis durch die Einbeziehung anderer Einkunftsarten (also nicht nur des Erwerbseinkommens der unselbständig Beschäftigten), ließ man offensichtlich unberücksichtigt. Wären alle Einkünfte, unabhängig davon, durch wen und wodurch sie entstehen, in die Rentenversicherung einbezogen (Selbständige, Beamte, Miet- und Zinseinnahmen, die Wertschöpfung der Unternehmen etc.), wäre die effektive Belastung des Einzelnen - bei gleichem Leistungsumfang der Rentenversicherung - drastisch zurückgegangen, die Nettolöhne der Erwerbstätigen mithin gestiegen. Dann stünde wieder ausreichend Kapital zur privaten Vorsorge zur Verfügung. Den Beitragszahlern, wie bei der Riester-Rente geschehen, die private Vorsorge zusätzlich zu den hohen Beiträgen (also ohne Kompensation) aufzuhalsen, ist zweifellos der falsche Weg, denn in der Konsequenz zahlen sie dann, addiert man die gesetzlichen und die privaten Beiträge, mehr als je zuvor. Die staatliche Förderung kann das nur unzureichend kompensieren. Das Schweizer Rentenmodell könnte als Vorbild dienen. Auch dort gibt es, wie bei uns, das Drei-Säulen-Modell aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Vorsorge. Aber im Gegensatz zur hiesigen Regelung zahlen dort außer den Kindern alle Einwohner in die erste Säule, die AHV (Alters- und Hinterlassenenversicherung), ein - auch Hausfrauen und Selbständige. "Außerdem werden nicht nur die Erwerbseinkommen, sondern auch Einkünfte wie etwa Mieten und Kapitalerträge herangezogen. Es gibt keine Beitragsbemessungsgrenze. Wer viel verdient, muß viel zahlen. Der Mindestbeitrag für Menschen, die kein eigenes Einkommen haben, liegt von 2003 an bei 425 Schweizer Franken (288 Euro) im Jahr. Abhängig Beschäftigte und ihre Arbeitgeber zahlen je 4,2 Prozent des Einkommens, Selbständige 7,8 Prozent. Die monatliche Höchstrente liegt, egal wie viel an Beiträgen gezahlt wurde, von Januar nächsten Jahres an bei 2.110 Schweizer Franken oder 1.428 Euro." [37] Reicht die gesetzlich festgelegte Mindestrente, deren Höhe sich auf die Hälfte der Höchstrente beläuft (714 Euro), nicht aus, springen die Kantone mit Ergänzungsleistungen ein. Die AHV-Rente wird regelmäßig dem Lohn- und Preisniveau angepaßt und teils staatlich mit Geld aus Tabakzöllen und der Steuerbelastung "gebrannter Wasser" subventioniert. Die zweite Säule des Schweizer Rentenmodells ist das Bundesgesetz für berufliche Vorsorge (BVG). Hier zahlen Angestellte und Unternehmen in eine Pensionskasse ein, die ab einem Jahreslohn von umgerechnet 17.137 Euro Pflicht ist. 80 Prozent der Erwerbstätigen kommen so in den Genuß betrieblicher Renten. Selbständige können sich versichern, müssen es aber nicht. Arbeitnehmer zahlen zwischen 3,5 und 9 Prozent ihres Einkommens in die Pensionskassen ein. Auch die Arbeitgeber geben einen (meist geringeren) Anteil hinzu. Per Kapitaldeckungsverfahren wird samt Zinsen ein Kapitalstock aufgebaut, aus dem im Alter eine entsprechende Rente finanziert wird. Die Selbstvorsorge, Säule Nummer drei, wird in der Schweiz überdurchschnittlich stark genutzt - auch, weil sie steuerlich abzugsfähig ist. Die freiwillige private Vorsorge macht dort 26 Prozent der Rente aus, 32 Prozent bestreiten die Betriebskassen, 42 Prozent die obligatorische Rentenversicherung. "Laut jüngsten Berechnungen ist die AHV, das stärkste Bein des Rentensystems, bis zum Jahr 2005 kapitalgedeckt. Lücken ergeben sich erst nach 2010, wenn auch in der Schweiz die demographische Entwicklung und die Wirkung veränderter Arbeitsverhältnisse spürbar werden. Muß die AHV dann die Beiträge erhöhen, bleibt die Belastung erträglich, da alle einzahlen." [38] An den demographischen Veränderungen unserer Gesellschaft kommt kein Rentensystem, gleichgültig wie es aussehen mag, vorbei. Durch die Verbreiterung der Beitragsbasis kann diese Veränderung aber besser aufgefangen werden. Die Altersvorsorge in zunehmendem Maße den Arbeitnehmern selbst zu überantworten, ist freilich die eindeutig schlechtere Lösung.  Sozialleistungen Die Sozialleistungsquote, der Anteil aller Sozialleistungen am Bruttoinlandsprodukt, ist in den letzten zehn Jahren um 3,9 Prozentpunkte angewachsen. Die Sozialhilfe (2000: 25,7 Mrd. Euro), bei Populisten mit Abstand der beliebteste Einsparposten, hatte daran allerdings nur einen minimalen Anteil, nämlich gerade mal 1,2 Prozent. Selbst das Arbeitslosengeld der Bundesanstalt für Arbeit (2000: 50,7 Mrd. Euro) belief sich - trotz hoher Arbeitslosigkeit - auf lediglich 2,5 Prozent des BIP. [39] Bei den vermeintlichen "Faulenzern und Drückebergern" (Bundeskanzler Gerhard Schröder) ist also vergleichsweise wenig einzusparen, die Streichorgie zu Lasten der ärmsten Bevölkerungsschichten geht mithin am zentralen Problem, der mangelnden Binnenkonjunktur und der Verschiebung der Steuer- und Abgabenlast zu Ungunsten der Arbeitnehmer, konsequent vorbei. Dies wird sich bitter rächen, denn neoliberale Rotstiftpolitik kann letztlich nur zu den gleichen Ergebnissen führen. Nicht ohne Grund ist ja die Arbeitslosenzahl heute so hoch wie am Ende der Amtszeit Helmut Kohls (rund vier Millionen). Dabei ist es völlig unerheblich, ob dies nun unter rot-grünem oder unter schwarz-gelbem Etikett geschieht. Deshalb wird letztlich wohl auch das Hartz-Konzept wirkungslos bleiben, weil es in erster Linie ein Einsparkonzept ist. Wie man Arbeitsplätze, die es gar nicht gibt, schneller vermitteln möchte, ist rätselhaft. Ältere Langzeitarbeitslose sollen jedoch ab 55 mit dem sogenannten "Brückengeld", das der Hälfte des Arbeitslosengeldes entspricht, auf das sie sonst Anspruch hätten, aus der Arbeitslosenstatistik ausgegliedert werden. Im letzten Jahr mußte ein verheirateter Arbeitslosengeld-Bezieher in Frankfurt mit 843 Euro auskommen, ein Lediger brachte es im Durchschnitt auf 760 Euro. Arbeitslosenhilfe-Bezieher erhielten erheblich weniger, nämlich ganze 537 Euro. [40] Faktisch bedeutet das um 50 Prozent reduzierte "Brückengeld" für den betroffenen Personenkreis eine Verringerung auf Sozialhilfeniveau. Wer mehr als dreißig Jahre lang in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hat, dann aber zwecks Beschönigung der Arbeitslosenstatistik auf Sozialhilfeniveau landet, wird sich gewiß bedanken. Ausufernde Sozialleistungen kann sich kein Gemeinwesen erlauben, insbesondere die zunehmend negative Entwicklung des demographischen Aufbaus der Bevölkerung wird uns noch gewaltige Schwierigkeiten bereiten. Hier kollidiert nämlich das Anwachsen der Leistungsempfänger mit dem Schrumpfen der Leistungserbringer - eine Kluft, die immer breiter und damit langfristig in der Tat unbezahlbar wird. Die Bundesregierung versucht das mit dem Kürzen bei den Leistungen und einer höheren Belastung der Beitragszahler aufzufangen. Ein fataler Irrweg. Vielmehr ist das Prinzip, die Sozialleistungen hauptsächlich durch die Beiträge der abhängig Beschäftigten zu finanzieren, grundsätzlich in Frage zu stellen. Wenn man die Beitragsbasis durch die Einbeziehung sämtlicher Einkommen verbreitert, gleichgültig wodurch sie erzielt werden, sinkt die Belastung des Einzelnen (siehe Kapitel Rentenreform). Das ist m.E. der bessere Weg.
 Sparprogramm Es ist unbestritten: Die exorbitanten Staatsschulden müssen abgebaut werden. Aber auf welche Weise dies zu geschehen hat, darüber darf man mit Fug und Recht streiten. Ob es volkswirtschaftlich wirklich klug ist, das Haushaltsdefizit auch in einer Rezession relativ rasch auf Null zurückzuführen, muß energisch bestritten werden. John Maynard Keynes (1883-1946) hielt in Zeiten der Rezession eine staatliche Stimulierung der Nachfrage für angebracht, um hierdurch die Wirtschaft anzukurbeln. Der nach ihm benannte Keynesianismus forderte, sich konsequent antizyklisch zu verhalten. Das heißt, in der Krise durch Ausweitung der Staatsverschuldung zusätzliche Nachfrage herstellen (deficit spending), während man in der Boomphase die vorher angehäuften Schulden durch Steuererhöhungen wieder reduziert. Die Bundesregierung verhält sich demgegenüber prozyklisch. Gerade in der Krise fährt man durch konsequentes Sparen die Nachfrage noch weiter zu zurück, weil der Staat seine Investitionen spürbar reduziert. Vor dreißig Jahren hatten die staatlichen Bruttoinvestitionen am Bruttoinlandsprodukt noch einen Anteil von 4,8 Prozent, mittlerweile sind sie auf 1,6 Prozent gesunken. Die Krise verschärft sich folglich. Daß sich frühere Regierungen selbst in Aufschwungphasen nicht an das Gebot des Schuldenabbaus gehalten haben, darf jetzt nicht dazu führen, ohne Rücksicht auf Verluste alles kaputt zu sparen. Eine geringe, etwas hinter der Steigerungsrate des Wirtschaftswachstum zurückbleibende Ausweitung der Staatsschuld würde einerseits die Nachfrage ausweiten, andererseits aber das Ziel des Schuldenabbaus nicht gefährden. Es würde lediglich etwas länger dauern. Gut, gegenwärtig liegen wir bereits über der Schwelle des Maastricht-Kriteriums von 3 Prozent, eine Ausweitung der Staatsschuld kommt von daher wohl kaum in Betracht. Es ist aber vor diesem Hintergrund völlig unverständlich, daß der Staat nach wie vor großzügig auf die Wiedereinführung der Vermögensteuer verzichtet, 1996 brachte sie immerhin ein Aufkommen von 4,5 Mrd. Euro. Durch die zwischenzeitlich erfolgte Vermögenssteigerung rechnet man heute mit einem Aufkommen von 8,5 Mrd. [42] Und eine Verbreiterung der Beitragsbasis bei den Sozialsystemen würde natürlich auch die öffentlichen Haushalte spürbar entlasten. Es ist unabdingbar, die Haushalte wieder auf eine gesunde Einnahmebasis zu stellen. Sparen allein ist aber letztlich kontraproduktiv, weil es die Krise nur noch weiter verschärft. Zudem lauert die Gefahr einer Ausweitung der Gerechtigkeitslücke, da es oft genug die Falschen trifft.
 Vermögensverteilung Zu guter Letzt wollen wir uns der Frage widmen, ob im Rahmen einer maßvollen Umverteilung der Vermögen überhaupt Manövriermasse vorhanden ist. Wie die Bundesregierung in ihrem ersten Armuts- und Reichtumsbericht festgestellt hat, ist ausreichend Manövriermasse vorhanden. "So waren 1998 im früheren Bundesgebiet rd. 42% des Privatvermögens im Besitz der vermögendsten 10% der Haushalte, während den unteren 50% der Haushalte nur 4,5% des Vermögens gehörten. Das oberste Zehntel besaß im Durchschnitt ein Vermögen von rd. 1,1 Mio. DM. Für die untere Hälfte ergab sich dagegen ein durchschnittliches Vermögen von 22.000 DM. In den neuen Ländern war die Ungleichheit der Vermögensverteilung noch größer. Die reichsten 10% der Haushalte besaßen im Durchschnitt rd. 422.000 DM und damit etwa 48% des gesamten Vermögens. Die untere Hälfte der Haushalte verfügte dagegen ebenso wie im früheren Bundesgebiet lediglich über 4,5% des gesamten Vermögens, bei einem durchschnittlichen Vermögen pro Haushalt von 8.000 DM." [44] Dies läßt sich mit der Diffamierung der Vermögensteuer als "Neidsteuer" nicht wegdiskutieren, denn es geht hier um den gerechten Beitrag der Vermögenden zur Finanzierung des Gesellschaftswesens. Nach den Plänen der SPD-geführten Bundesländer Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen soll ab 01.01.2004 eine einprozentige Vermögensteuer erhoben werden. Für Alleinstehende wird es danach bei Geld-, Grund- und Immobilienvermögen einen Freibetrag in Höhe von 300.000 Euro geben, für Verheiratete 600.000 Euro sowie zusätzlich 200.000 Euro für jedes Kind. Für Betriebsvermögen soll ein Freibetrag von 2,5 Mio. Euro gewährt werden (Gesamtvermögen abzüglich der Schulden). [45] Angesichts der Freibeträge wäre die Masse der Steuerzahler davon überhaupt nicht betroffen. Die Vermögensteuer wird die ungerechte Verteilung des Vermögens nicht grundlegend korrigieren, aber sie wird dafür sorgen, daß die Vermögenden gemäß Artikel 14, Abs. 2 Grundgesetz ("Eigentum verpflichtet"), entsprechend ihrem Leistungsvermögen zum Allgemeinwohl beitragen. Die Gerechtigkeitslücke würde sich mithin etwas schließen.  Fazit: Wir befinden uns mindestens seit Beginn der achtziger Jahre in einem fatalen Teufelskreis: Die Arbeitnehmer haben am gesellschaftlichen Reichtum einen immer geringeren Anteil, was über zurückgehende Massenkaufkraft die Binnenkonjunktur negativ beeinflußt. Die Unternehmen investieren nur noch unzureichend und reagieren, um Kosten zu sparen, mit dem Abbau von Arbeitsplätzen. Die Kaufkraft wird hierdurch abermals geschmälert. Da die Sozialsysteme fast ausschließlich von den Beiträgen der Erwerbstätigen abhängen, schrumpft bei steigender Arbeitslosigkeit deren Beitragsaufkommen, woraus wiederum die Schwierigkeiten auf der Einnahmeseite resultieren. Der Staat antwortet darauf seinerseits mit Sparprogrammen, was natürlich schädliche Konsequenzen für den Binnenmarkt zeitigt. Die Wachstumsraten knicken ein, weitere Sparprogramme (der Unternehmen und des Staates) sind damit vorprogrammiert. Dieser Teufelskreis wurde von den Erfolgen auf den Exportmärkten lange Zeit überdeckt, nun wird er offensichtlich. Und er kann nur aufgebrochen werden, wenn der gesellschaftliche Reichtum anders, d.h. gerechter verteilt wird. Volkswirtschaftlich betrachtet geht es uns nach wie vor relativ gut, allerdings muß die Verteilung entscheidend geändert werden. Hierbei sind m.E. fünf Punkte unabdingbar:
Die Krise unseres Wirtschaftssystems ist durch eine falsche Wirtschaftspolitik weitgehend hausgemacht, aus diesem Grund ist sie auch vom Grundsatz her in den Griff zu bekommen. Insofern sind wir ihr keineswegs hilflos ausgeliefert. Wir dürfen das Allgemeinwohl nur nicht den eigensüchtigen und kurzfristigen Motiven mächtiger Interessengruppen ausliefern. Im Zweifelsfall muß das Gemeinwohl stets den Vorzug genießen. Die eigentliche Krise ist jedoch in Wahrheit die fehlende politische Alternative. Gegenwärtig sind alle relevanten politischen Parteien dem neoliberalen Gesellschaftsmodell mehr oder minder verhaftet. Die Änderung des politischen Willens muß der Änderung der politischen Praxis zwangsläufig vorausgehen. Man kann nur hoffen, daß dies rechtzeitig erfolgt, bevor die sozialen Auswirkungen im politischen System Schlimmeres anrichten. ---------- [1] Statistisches Taschenbuch 2002, Tabelle 2.10 [2] Frankfurter Rundschau v. 01.10.2002 [3] Frankfurter Rundschau v. 21.11.2002 [4] Arbeitsproduktivität je Erwerbstätigenstunde [5] Statistisches Taschenbuch 2002, Tabelle 1.7 [6] Bundesumweltamt, Umweltdaten Deutschland 2002, Seite 33 [7] DIW Berlin, Wochenbericht 6/01 [8] Ernst Ulrich von Weizsäcker / Amory Lovins / L. Hunter Lovins, Faktor Vier, München 1995 [9] Statistisches Taschenbuch 2002, Tabelle 1.2 [10] Statistisches Taschenbuch 2002, Tabelle 2.10 [11] Fischer Weltalmanach 2003, Seite 1218 [12] Frankfurter Rundschau v. 16.10.1997 [13] Frankfurter Rundschau v. 20.11.2002 [14] Fischer Weltalmanach 2003, Seite 184 u. 1220 [15] Fischer Weltalmanach 2003 [16] Wirtschaftskammern Österreichs, Quelle: OECD [17] Statistisches Taschenbuch 2002, Tabelle 1.2 [18] Statistisches Taschenbuch 2002, Tabelle 1.13 u. 1.14 [19] Statistisches Taschenbuch 2002, Tabelle 1.15 [20] Frankfurter Rundschau v. 15.11.2002 [21] Statistisches Taschenbuch 2002, Tabelle 1.17 [22] Fischer Weltalmanach 2003, Seite 287 [23] "Anfang 2001 wurde zum einen die Körperschaftsteuer auf den einheitlichen Satz von 25 Prozent gesenkt. Rückwirkend können Unternehmen einbehaltene Gewinne auflösen und an die Aktionäre ausschütten. Für einbehaltene Erträge betrug bis 1998 der Steuersatz 45 und seit 1999 dann 40 Prozent. Für ausgeschüttete Gewinne mussten zuvor 35 Prozent abgeführt werden. Firmen, die nun nachträglich in Rücklagen versteckte Gewinne auflösen, bekommen vom Fiskus die Differenz zum aktuellen Satz von 25 Prozent zurückerstattet. Der damit verbundene finanzielle Effekt wird auf mehr als 35 Milliarden Euro geschätzt. Die Körperschaftsteuer fließt je zur Hälfte (...) Bund und Ländern zu." (Frankfurter Rundschau v. 28.11.2002) [24] Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Jahresgutachten 2002/2003, Tabelle 30 [25] den Spitzensteuersatz von 53 % im Jahr 1998 auf 42 % im Jahr 2005, den Eingangssteuersatz im gleichen Zeitraum von 25,9 % auf 15 % [26] SPD-Wahlprogramm für die Bundestagswahl 1998, Seite 26 [27] Bundesministerium der Finanzen, - Referat Presse und Information -, 14. Juli 2000 [28] Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen), Info für Aktive Nr. 17/2002 vom 8. Oktober 2002 [29] Umlageverfahren = die aktuellen Rentenzahlungen werden durch die laufenden Einkommen der Beitragszahler abgedeckt Kapitaldeckungsverfahren = die zukünftigen Rentenzahlungen werden durch die Ansammlung und Verzinsung von Ersparnissen finanziert [30] Hans-Jürgen Urban, Ferne Signale aus einer untergegangenen sozialpolitischen Welt, Frankfurter Rundschau v. 18.09.2000 [31] Franz Ruland, Frankfurter Rundschau v. 18.10.2000 [32] Wolfgang Scherf, Vortrag vom 9.12.1996 in der Vortragsreihe "Sozialstaat" der Justus-Liebig-Universität Gießen [33] Winfried Schmähl, Frankfurter Rundschau v. 08.08.2000 [34] Dieter Oberndörfer, Nur Zuwanderung sichert den Wohlstand Deutschlands, Frankfurter Rundschau v. 21.01.2002 [35] Wolfgang Scherf, Vortrag vom 9.12.1996 in der Vortragsreihe "Sozialstaat" der Justus-Liebig-Universität Gießen [36] Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, Frankfurter Rundschau v. 09.10.2000 [37] Frankfurter Rundschau v. 22.11.2002 [38] Frankfurter Rundschau v. 22.10.1999 [39] Fischer Weltalmanach 2003, Seite 283 u. 284 [40] Frankfurter Rundschau v. 09.05.2001 [41] Statistisches Jahrbuch 2002, Tabelle 7.2 [42] Frankfurter Rundschau v. 01.10.2002 [43] Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Jahresgutachten 2002/2003, Tabelle 29 [44] Lebenslagen in Deutschland, Erster Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung [45] Frankfurter Rundschau v. 27.11.2002 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
