
| Home | Archiv
| Impressum 19. Oktober 2004, von Michael Schöfer Nur Managementfehler? General Motors, die Mutter des defizitären Autobauers Opel, will demnächst allein in Deutschland 10.000 Arbeitsplätze abbauen. Das heißt, es stehen Massenentlassungen und unter Umständen sogar ganze Werksschließungen vor der Tür. Die Einzelhandelskette Spar hat ebenfalls drastische Personalreduzierungen angekündigt, 1.000 von derzeit 3.600 Stellen sollen in Kürze wegfallen. Und beim in die Krise geratenen Kaufhauskonzern Karstadt-Quelle werden - sozialverträglich, wie es heißt - 5.500 Arbeitsplätze eliminiert. Das sind allerdings nur spektakuläre Einzelfälle, sozusagen die Spitze des Eisbergs. In Wahrheit ist der Arbeitsplatzabbau in Deutschland viel dramatischer. Dem Management von Opel und Karstadt-Quelle werden von Seiten der Politik, den Gewerkschaften und den Betriebsräten verheerende Managementfehler vorgeworfen, die für die schmerzhaften Einschnitte beim Personal verantwortlich seien. Nieten in Nadelstreifen sozusagen. Es mag richtig sein, der Führung von Opel und Karstadt-Quelle Mißmanagement vorzuwerfen, doch ist das nur die halbe Wahrheit. Die Klagen über Managementfehler verdecken nämlich den Blick auf die eigentliche Ursache der Krise. Diese ist weniger auf der einzelbetrieblichen Ebene zu suchen, sondern hauptsächlich auf der gesamtwirtschaftlichen. Über die schwierigen, von der Politik (ob Rot-Grün oder Schwarz-Gelb) selbst herbeigeführten negativen Rahmenbedingungen spricht leider kaum jemand. Zumindest nicht im Zusammenhang mit Opel und Karstadt-Quelle. Daran haben Schröder, Clement & Co. logischerweise kein Interesse. Es ist eben wesentlich leichter und populärer, auf die hochbezahlten und in der Bevölkerung ziemlich unbeliebten Manager einzuprügeln. Helfen können sich die taumelnden Unternehmen indes nur begrenzt, die Lösung der Misere liegt vielmehr in einer grundsätzlich anderen Wirtschaftspolitik. Die ökonomischen Rahmenbedingungen müssen sich spürbar verändern, erst dann kann krisengeschüttelten Betrieben oder ganzen Branchen wirklich geholfen werden. Im Jahr 2003 lagen die Umsätze des deutschen Einzelhandels 1,4 Prozent unter (!) dem Wert von vor zehn Jahren. [1] Und die Neuzulassungen von Personenkraftwagen gehen hierzulande nun schon vier Jahre hintereinander zurück. [2] Das ist Ausfluß der tiefgreifenden Konsumkrise auf dem hiesigen Binnenmarkt, die aus dem drastischen Rückgang der Nettorealverdienste der abhängig Beschäftigten resultiert (Nettorealverdienste = Bruttoverdienste um die Inflationsrate bereinigt, abzüglich Steuern und Sozialabgaben). So waren in Deutschland im vergangenen Jahr die durchschnittlichen realen Nettoeinkommen 5,2 Prozent niedriger als eine Dekade zuvor. [3] Es ist evident, daß in schrumpfenden Märkten, also bei kaufkraftbedingten Umsatzeinbußen, unter den Betrieben der betroffenen Branchen unausweichlich ein Ausleseprozeß einsetzt, dem notwendigerweise das ein oder andere Unternehmen zum Opfer fallen muß. Irgendein Unternehmen trifft es immer, es fragt sich bloß welches. Es geht folglich nicht um das Ob, sondern um das konkrete Wie. Natürlich sind die am schlechtesten aufgestellten Betriebe als erste an der Reihe, wenn derartige Marktbereinigungen stattfinden. Insofern ist die Krise von Opel und Karstadt-Quelle nachvollziehbar. Früher gab es vier große Warenhausketten: Hertie, Horten, Karstadt und Kaufhof. Hertie wurde von Karstadt geschluckt, Horten von Kaufhof. Gegenwärtig beobachten wir im Bereich des Einzelhandels abermals eine einschneidende Marktbereinigung, bei der vielleicht am Ende nur noch Kaufhof überleben wird. In der Automobilindustrie ist es ähnlich. Wären nicht VW und Opel in der Krise, dann eben andere. Aber daß irgendein Unternehmen im Verdrängungswettbewerb auf der Strecke zu bleiben droht, ist einleuchtend. Bei schrumpfenden Märkten kann es nicht allen zusammen gut gehen. Entweder schrumpfen, was unwahrscheinlich ist, sämtliche Unternehmen gemeinsam in gleichem Maße oder einzelne Mitspieler scheiden zwangsläufig irgendwann aus dem Spiel aus. Da der Kuchen immer kleiner wird, gibt es erfahrungsgemäß weniger zu verteilen. Eine Binsenweisheit. Auch wenn sich jeder noch so sehr abstrampelt, der Kuchen wird dadurch nicht größer, dafür aber der Streit um die jeweiligen Anteile daran. Im Umkehrschluß bedeutet das: Wer derartige Marktbereinigungen verhindern will, muß die Märkte zum Wachsen bringen. Und wie bringt man Märkte zum Wachsen? Nun, indem man die zur Verfügung stehende Kaufkraft stärkt. Zwar redet das politische Establishment andauernd von einer Stärkung der Kaufkraft, doch betreibt es in der Praxis fortwährend das genaue Gegenteil. Rot-Grün entlastet durch die partielle Aufgabe der paritätischen Beitragsfinanzierung in der Renten- und Krankenversicherung ausschließlich die Unternehmen, bislang freilich ohne positive Auswirkung auf die Zahl der Arbeitsplätze. Die Arbeitnehmer jedoch haben dadurch von Mal zu Mal weniger Geld zum Konsumieren übrig. Ab 2005 tragen sie beispielsweise die Kosten für den Zahnersatz ganz allein, aus diesem Grund erhöht sich ihr Krankenkassenbeitrag um 0,9 Prozentpunkte. Im gleichen Ausmaß sollen die Krankenkassenbeiträge reduziert werden. Klingt nach einem Nullsummenspiel, ist aber keins. Da die Arbeitgeber von den Krankenkassenbeiträgen bis dato 50 Prozent bezahlt haben, bekommen sie durch die Beitragssatzreduzierung eine Entlastung um 0,45 Prozentpunkte. Die Beschäftigten hingegen müssen künftig einen um 0,9 Prozentpunkte erhöhten Beitragssatz entrichten, bekommen aber durch die Beitragsreduzierung lediglich 0,45 Prozentpunkte zurück. Mit anderen Worten: Den Arbeitnehmern steckt man 50 Cent in die linke Tasche und holt ihnen gleichzeitig aus der rechten Tasche einen ganzen Euro heraus. Die von der Union geplante Kopfpauschale hat auf die unteren und mittleren Einkommen eine noch verhängnisvollere Wirkung. Die Einführung der Kopfpauschale wäre daher, was die Nachfrage angeht, ebenso kontraproduktiv. Darüber hinaus ist bei diesem Konzept die Finanzierung nach wie vor völlig ungewiß. Wie man vor diesem Hintergrund die Wirtschaft ankurbeln und die Konsumausgaben anregen will, ist mir ehrlich gesagt schleierhaft. Die Menschen können schließlich nur das ausgeben, was man ihnen in der Tasche läßt. So haben - gesamtwirtschaftlich betrachtet - sinkende Einkommen der Arbeitnehmer rückläufige Umsätze bei den Unternehmen und verminderte Steuereinnahmen des Staates zur Folge. Ergo wird an allen Ecken und Enden gespart. Und das vorwiegend zum Nachteil der Arbeitnehmer (in Form von Entlassungen respektive Lohnkürzungen) und der Erwerbslosen (in Form von Einschränkungen im Sozialbereich). Dadurch gehen die Umsätze in den konsumnahen Branchen des Binnenmarkts noch weiter zurück, werden - bei gleichzeitig wachsendem Finanzierungsbedarf - erneut weniger Steuern eingenommen, was abermals harte Sparmaßnahmen provoziert. Ein positiver Rückkopplungseffekt bzw. eine sich selbst verstärkende soziale Abwärtsspirale. Hierdurch wird keinem richtig geholfen, und am Ende leiden alle. Dieser fatale Teufelskreis muß endlich durchbrochen werden. Wir brauchen wieder eine Politik, die die Massenkaufkraft stärkt. Nicht mit Worten, sondern mit Taten. Geld, man beachte die riesigen Außenhandelsüberschüsse, ist genug vorhanden. Nur eben in den falschen Händen. Wir brauchen eine echte Umverteilung von oben nach unten, denn die Porsche-Fahrer allein reißen es nicht heraus. Deshalb könnte die Erhöhung des Spitzensteuersatzes sowie der Erbschaftsteuer, die Wiedereinführung der Vermögensteuer und die Abschaffung des Ehegattensplittings äußerst hilfreich sein. Das Geld muß dorthin, wo Konsumbedarf besteht. Nicht dorthin, wo es vor allem die Aktiendepots vergrößert. Wenn die Massenkaufkraft steigt, wird mehr konsumiert. Wenn mehr konsumiert wird, erhöhen sich die Umsätze der Unternehmen. Wenn sich die Umsätze der Unternehmen erhöhen und ihre Kapazitäten ausgelastet sind, investieren sie auch wieder. Und wenn mehr investiert wird, sinkt die Arbeitslosigkeit und steigen die Steuereinnahmen. Mehr Beschäftigung hat eine nachlassende Beitragsbelastung zur Folge, was sich wiederum positiv auf die Nettoeinkommen und damit auf die Kaufkraft auswirkt. Mit einem Wort: Was wir brauchen, ist eine Aufwärtsspirale. Durch Sparen und Kürzen kann man eine Wirtschaft nicht beleben, denn der Aufschwung läßt sich nicht herbeisparen. Franklin D. Roosevelt mit seinem "New Deal" und John Maynard Keynes mit seinem "Deficit Spending" haben das noch gewußt. Was falsche Politik bewirken kann, dafür gibt es in ausreichendem Maße abschreckende Beispiele. Argentinien etwa galt in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts als die Schweiz Südamerikas. Heute ist das Land heruntergewirtschaftet und praktisch pleite. Es gibt keine Garantie, daß es uns nicht ähnlich ergeht. 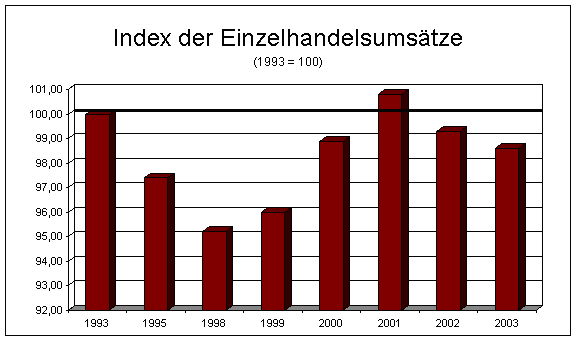 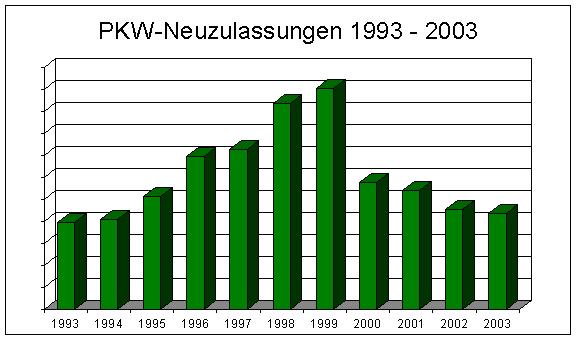
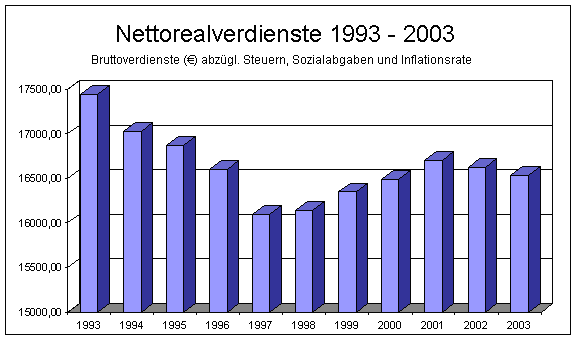 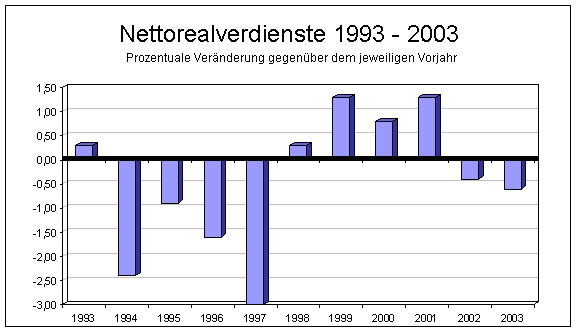
[1] Frankfurter Rundschau vom 01.10.2004 [2] Verband der Automobilindustrie [3] Statistisches Taschenbuch, Tabelle 1.15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
