
| Home
| Archiv
| Impressum 12. Mai 2002, von Michael Schöfer Verdient Rot-Grün eine zweite Chance? Am 22. September 2002 sind wieder Wahlen zum Deutschen Bundestag. Anlaß genug, über die bisherige Arbeit der rot-grünen Bundesregierung kritisch Bilanz zu ziehen. Hat die Regierung Schröder den Erwartungen der Wähler entsprochen und sich den vorher propagierten Zielen zumindest angenähert, oder hat man die eigenen Ziele längst aus den Augen verloren und damit das Wahlvolk nachhaltig enttäuscht? Fragen, die vor der Bundestagswahl im September 2002 beantwortet werden sollten, denn daraus resultiert für jeden unmittelbar die eigene Wahlentscheidung. Soll man dem Wähler Rot-Grün empfehlen? Vor vier Jahren wurde die deutsche Bevölkerung der konservativ-liberalen Regierung definitiv überdrüssig. Das Resultat der neoliberalen Politik Helmut Kohls war ein ungeheurer Anstieg der Arbeitslosenzahlen (im Jahresdurchschnitt von 1,8 Mio. auf 4,3 Mio.) [1], der Staatsverschuldung (im Bund von 308 Mrd. DM = 19,4 % des BIP auf 954 Mrd. = 25,1 % des BIP) [2] und der Armut (Sozialhilfeempfänger von 0,85 Mio. auf 2,8 Mio.) [3]. Die Entsolidarisierung der Gesellschaft schritt in diesen Jahren schier unaufhaltsam voran, statt den versprochenen "blühenden Landschaften" erntete man jedoch bloß anhaltenden Sozialabbau. Das Vertrauen in die Wirtschaftskompetenz der Union war nach 16 Jahren endgültig dahin, die Bürger sprachen sich deshalb am Wahltag mehrheitlich für den Versuch aus, die klaffende Gerechtigkeitslücke zu schließen. Diese Lücke zu schließen gelobte der damalige SPD-Kanzlerkandidat Gerhard Schröder. Mit ihm sollte nicht nur der Macht-, sondern auch der Politikwechsel exekutiert werden. "Unser Land braucht eine Politik für wirtschaftliche Dynamik und für neue Arbeitsplätze", hieß es folgerichtig im SPD-Wahlprogramm für die Bundestagswahl 1998. Deutschland brauche "eine Politik, die auf gesellschaftlichen Konsens zielt und auf soziale Gerechtigkeit." [4] Durch die Politik der "neuen Mitte" sollte es mit Deutschland wieder aufwärts gehen. Kurz nach Amtsantritt verkündete Schröder mit allem Nachdruck, seine Regierung wolle sich "jederzeit, nicht erst in vier Jahren, daran messen lassen", in welchem Maß sie zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit beigetragen habe. [5] "Den Politikwechsel versprachen auch die Grünen. Unter anderem propagierten sie in ihrem Wahlprogramm (Grün ist der Wechsel) "soziale Gerechtigkeit", den "sofortigen Ausstieg aus der Atomkraft" sowie "Abrüstung und Entmilitarisierung". [6] Nun, messen wir Rot-Grün an ihren eigenen Ansprüchen und greifen einige zentrale Politikfelder heraus. Arbeitslosigkeit Als Helmut Kohl im September 1998 für seine verfehlte Arbeitsmarktpolitik schmählich abgestraft wurde, waren in der Bundesrepublik exakt 3,97 Mio. Menschen arbeitslos. [7] Gegenwärtig, im April 2002, sind es jedoch 4,02 Mio., also praktisch genauso viele wie zur Zeit der Regierungsübernahme von Gerhard Schröder. [8] Allein diese Zahl dokumentiert das völlige Versagen der rot-grünen Bundesregierung. Entgegen der zur Halbzeit der Legislaturperiode vollmundig abgegebenen Ankündigung, die Zahl der Arbeitslosen bis zu den nächsten Bundestagswahlen im Jahr 2002 auf unter 3,5 Mio. zu reduzieren [9], verharrt die Arbeitslosigkeit, nach einem leichten, allerdings nur temporären Rückgang in den Jahren 2000 und 2001, weiterhin auf hohem Niveau. Das Frühjahrsgutachten der sechs führenden Wirtschaftsforschungsinstitute prognostiziert außerdem für 2002 und 2003 nur einen minimalen Rückgang auf 3,96 bzw. 3,81 Mio. [10] Jetzt rächen sich die falschen wirtschaftspolitischen Weichenstellungen von Rot-Grün. Woher sollen auch die Impulse für den Arbeitsmarkt kommen? Weder im Hinblick auf den Export noch unter Berücksichtigung der Lage des Binnenmarkts ist überschäumender Optimismus gerechtfertigt. Darüber hinaus wirkt das prozyklische Sparprogramm der Regierung konjunkturell kontraproduktiv. Börsencrash Nachdem die Blase an den Aktienmärkten im Jahr 2000 endlich platzte, rutschte die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten zwangsläufig in die Rezession. Die amerikanischen Verbraucher haben zwar am Bruttoinlandsprodukt der USA einen nicht unerheblichen Anteil (deutlich höher als in Europa) [11], doch hatte deren Verschuldung bereits vor dem Börsencrash riesige Ausmaße erreicht. Die Verschuldung der privaten Haushalte ist nämlich in den neunziger Jahren von etwa 3,3 Billionen auf mehr als 6,5 Billionen US-Dollar angewachsen, hat sich also innerhalb einer Dekade verdoppelt. [12] Dies wurde vorübergehend durch die - teilweise auf Pump finanzierte - Börsenspekulation ausgeglichen. Die Buchgewinne der Aktienhausse, wohlgemerkt nicht die Steigerung der Arbeitseinkommen (zwischen 1973 und 1996 stieg der Reallohn pro Arbeitsstunde um magere 1,8 Prozent) [13], puschten eine Zeitlang den Konsum. "Knapp 50% der US-amerikanischen Haushalte besitzen Aktien (ein Drittel davon über Pensionspläne des Arbeitgebers); Aktien machen rund ein Drittel des Vermögens der Privathaushalte aus." [14] Dies zeigt, wie sehr die amerikanische Konsumnachfrage von der Entwicklung an den Anlagemärkten abhängig ist. Demgegenüber besitzen in Deutschland lediglich 17,7 Prozent der Bevölkerung Aktien. [15] Nach dem Ende der Hausse war es folglich auch mit dem exzessiven Konsum vorbei. Die Sparquote der amerikanischen Privathaushalte ist mittlerweile negativ (minus 0,8 Prozent im Jahr 1999) [16], d.h. die Verbraucher leben dort seit längerem von der Substanz. In der Bundesrepublik ist sie hingegen mit 9,75 Prozent im Plus. [17] Nachdem die Kurse der Wertpapiere zusammengebrochen waren, fehlte einfach die zur Kurskorrektur notwendige Manövriermasse. Doch selbst wenn sich das demnächst - wider Erwarten - ändern sollte, ist es in hohem Maße fraglich, wie lange die amerikanischen Verbraucher noch durchzuhalten in der Lage sind. Schulden müssen schließlich irgendwann zurückgezahlt werden. Daran führt kein Weg vorbei, auch nicht im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Schuldnerland USA Ebenso miserabel ist die Bilanz der übrigen Volkswirtschaft. Das letzte Jahr, in dem die Vereinigten Staaten einen Handelsbilanzüberschuß erwirtschafteten, war das Jahr 1975. [18] Seitdem erzielen sie beträchtliche, weiterhin beängstigend anwachsende Defizite (im Jahr 2001 ein Minus von 425 Mrd. Dollar). [19] Daraus resultiert der unumstrittene Spitzenplatz bei der Auslandsverschuldung. Präzise Angaben sind leider nicht zu erhalten, jedoch taxiert man die Nettoschuld der amerikanischen Volkswirtschaft auf etwa 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). [20] In Zahlen ausgedrückt wären das rund 3,5 Billionen US-Dollar, erheblich mehr als alle Entwicklungsländer zusammen. [21] Und die Verbindlichkeiten der amerikanischen Unternehmen schätzt man inzwischen auf etwa 13 Billionen Dollar. [22] Man darf sich folglich vom, durch massiven Sozialabbau erkauften Ausgleich der öffentlichen Haushalte unter Präsident Clinton nicht täuschen lassen. Die USA stehen weiterhin vor einem gewaltigen Schuldenberg: Am 29. April 2002 betrug der öffentliche Schuldenstand 5,97 Billionen Dollar (rund 66 Prozent des BIP). [23] Das ist zwar von der Relation her ein in etwa mit der deutschen Staatsverschuldung (58,2 % des BIP im Jahr 1999) [24] vergleichbares Niveau, jedoch ist unsere strukturelle Situation vollkommen anders. Erstens erwirtschaften wir im Außenhandel nach wie vor enorme Überschüsse (im Jahr 2000 102,9 Mrd. DM bzw. 52,6 Mrd. Euro) [25], und zweitens treten wir im Ausland als Gläubiger, nicht als Schuldner auf. Dies kompensiert, volkswirtschaftlich betrachtet, die beklagenswerte binnenwirtschaftliche Verteilungsgerechtigkeit in Deutschland. [26] Fazit: Die Vereinigten Staaten sind ein ökonomischer Riese auf tönernen Füßen, der sich nur noch durch die immensen Finanzzuflüsse (vor allem aus Japan) über Wasser hält. Bricht dieser Strom - aus welchen Gründen auch immer - einmal ab, wäre das geradezu katastrophal. Insofern sollten die USA für uns kein Vorbild sein. Ungesunde Exportorientierung Aufmerksamen Beobachtern mußte eigentlich schon vorher klar geworden sein, daß die explodierenden Aktienkurse in der realen Wirtschaft keine Entsprechung finden können. Dreistellige Zuwachsraten an der Börse decken sich bekanntlich nicht mit einstelligen, höchstens zweistelligen Umsatz- bzw. Kapitalrenditen der Unternehmen. [27] Man hat sich diesbezüglich viel zu sehr von der vermeintlichen Performance der "New Economy" blenden lassen. Im Bereich der Wirtschaft - und nicht nur dort - hat Selbstbetrug allerdings fatale Folgen. Ökonomische Wahrheiten lassen sich auf Dauer einfach nicht gänzlich ignorieren. Rot-Grün vertraute indes, ebenso wie die konservativ-liberale Vorgängerregierung, hauptsächlich auf die Zugkraft der US-Ökonomie. Lahmt dieses Zugpferd jedoch, gerät damit automatisch auch die exportorientierte deutsche Wirtschaft ins Schlingern.  Anhaltende Außenhandelsdefizite der USA könnten beispielsweise auf lange Sicht in einen schwächer werdenden Dollar münden, was wiederum erhebliche Risiken für unseren eigenen Außenhandel nach sich ziehen würde. Von einer Deflationsgefahr, die manche Ökonomen und Wirtschaftsjournalisten den Vereinigten Staaten prophezeien, und die Japan, wenn auch aus anderen Gründen, bereits ergriffen hat, will ich hier gar nicht sprechen. [28] In einer Deflation übertrifft das gesamtwirtschaftliche Angebot die Nachfrage. Ein durch die Nachfrageschwäche ausgelöster Prozeß anhaltender Preisniveausenkungen drückt auf die Gewinne der Unternehmen, die sich mit Investitionen zurückhalten und Kapazitäten abbauen. Folge: Die Arbeitslosigkeit nimmt zu, was die gesamtwirtschaftliche Nachfrage abermals reduziert und damit die deflationären Tendenzen noch weiter verstärkt (Deflationsspirale). Die Verschuldung der Privathaushalte, extreme Handelsbilanzdefizite, verbunden mit reduzierten Gewinnerwartungen der Unternehmen und daraus resultierenden Einbrüchen der Aktienkurse, könnten schließlich in einen derartigen Deflationsprozeß führen. Schulden machen sich dann übrigens viel stärker bemerkbar. Während die Inflation Geldvermögen und Schulden entwertet, wächst in einer Deflation deren realer Wert. Die Lage der Schuldner verschlechtert sich daher in zunehmendem Maße, je länger die Deflation anhält. In Japan kann die Nachfrage derzeit sogar durch eine faktische Nullzinspolitik nicht wieder in Gang gesetzt werden. [29] Gegenwärtig sinken dort die Konsumentenpreise um 2 Prozent pro Jahr. [30] Es entbehrt - beiläufig bemerkt - nicht einer gewissen Komik, daß Deutschland so stark auf die amerikanische Konsumnachfrage baut, mithin auf eine weitere Verschuldung der dortigen Verbraucher vertraut, während man sich selbst außerstande sieht, die eigene Binnennachfrage wirksam anzukurbeln. Die lahmende Binnenkonjunktur Der frühere SPD-Vorsitzende, Oskar Lafontaine, der schon 1990 - wie sich nachträglich herausgestellte - die besseren ökonomischen Konzepte in bezug auf die deutsche Wiedervereinigung vorlegte, damit aber als Kanzlerkandidat bedauerlicherweise gescheitert ist, hatte dies erkannt. "Der Export allein reicht nicht. Seit Jahren stagnieren die Netto-Reallöhne der Arbeitnehmer. Die Folge ist eine ausgeprägte Schwäche der inländischen Nachfrage. (...) Wir müssen den deutschen Binnenmarkt wieder in Schwung bringen. Deshalb brauchen wir eine vernünftige Lohnpolitik, die den Arbeitnehmern einen fairen Anteil am gemeinsam erarbeiteten Wohlstand sichert", schrieb er 1997 in einem Grundsatzpapier. [31] Beim "Kanzler der Bosse" (Gerhard Schröder) konnte Lafontaine damit natürlich nicht reüssieren. Die Politik nach Oskars plötzlichem Abgang fiel denn auch entsprechend aus. Die eindringlichen Warnungen, Deutschland müsse sich von der ungesunden Exportorientierung lösen und - durch Stärkung der Kaufkraft - den eigenen Binnenmarkt festigen, schlugen sich jedenfalls nicht in Regierungshandeln nieder. Die realen Tariflöhne legten zwar im ersten Regierungsjahr Gerhard Schröders kräftig zu (plus 2,3 Prozent im Jahr 1999), aber bereits im zweiten Regierungsjahr flaute dieser Trend schon wieder merklich ab (nur noch ein Plus von 0,5 Prozent), um dann im dritten, wie unter Helmut Kohl gewohnt [32], mit einem Minus von 0,4 Prozent zu Buche zu schlagen. [33] Natürlich soll man Rot-Grün nicht unrecht tun, die Bundesregierung hatte praktisch keinen Einfluß auf die im Jahr 2001 vom Anstieg der Energieimporte induzierte hohe Preissteigerungsrate. Dies ließ allerdings die am 01.01.2001 gestartete mehrstufige Steuerreform zunächst wirkungslos verpuffen. Wenn es die weltpolitische Lage erlaubt, könnte sich die Steuerentlastung in den kommenden Jahren aber doch noch bemerkbar machen. Dazu müßte es jedoch zu Preissenkungen kommen, was derzeit unwahrscheinlich erscheint. Verfehlte Steuerreform Gleichwohl muß man die Steuerreform selbst von ihrer Struktur her als verfehlt bezeichnen. Den Spitzensteuersatz um 0,1 Prozent mehr zurückzunehmen als den Eingangssteuersatz [34], ist wahrlich keine "Wiederherstellung der Steuergerechtigkeit". [35] Im Wahlprogramm versprach man noch, den Spitzensteuersatz auf lediglich 49 Prozent abzusenken, anstatt - wie realisiert - auf 42 Prozent. [36] Daraus folgt unweigerlich, daß die höheren Einkommen in absoluten Zahlen überproportional entlastet werden. Zudem profitieren dort Ledige deutlich mehr als Verheiratete oder Alleinstehende mit Kindern (vgl. Entlastungstabelle). [37] Muß, so kann man zu Recht fragen, ein Lediger mit 150.000 DM Jahreseinkommen wirklich eine höhere Entlastung bekommen, als ein Verheirateter mit zwei Kindern?
Die hohen Einkommen hätten hier durchaus eine deutlich weniger ausgeprägte Entlastung hinnehmen können. Früher war man sich bei Rot-Grün noch bewußt, daß die Belastung mit steigender Einkommenshöhe sinkt, weil die Konsumquote bei Niedrigverdienern sehr viel höher liegt als bei Besserverdienern. Letztere haben eben nach der Deckung ihrer Grundbedürfnisse mehr zur freien Verfügung. Doch die, die viel haben, können gar nicht entsprechend mehr konsumieren, sie stellen vielmehr ihr "überflüssiges" Einkommen in steigendem Ausmaß den Kapitalmärkten zur Verfügung. Vor allem daraus hat sich bei uns die Spekulationsblase genährt. Die, die dagegen wenig haben, würden gerne mehr konsumieren, können es aber nicht, weil es das Einkommen nicht zuläßt. Gerade hier wären finanzielle Entlastungen also auf fruchtbaren Boden gefallen und hätten somit den Binnenmarkt mehr gestärkt, als die letztlich umgesetzte Steuerreform (die im übrigen mit den "Petersberger Beschlüssen" der Union aus dem Jahr 1997 auffallend viele Ähnlichkeiten aufweist). Im Grunde geht es um die klassische Verteilungsfrage, die freilich vom neoliberalen Mainstream der Wirtschaftswissenschaft als obsolet bezeichnet wird. Von Rot-Grün hätte man in dieser Beziehung mehr Widerstand und deutlich andere Akzente erwartet. Gerechtigkeit Die Bundesrepublik ist ein Lohnsteuerstaat bzw. sie hat sich konsequent dahin entwickelt. Wie die nachfolgenden Tabellen zeigen, ist der Anteil der großen, von den Arbeitnehmern zu entrichteten Steuerarten (Lohnsteuer, Umsatzsteuer) erheblich gewachsen. Im Gegensatz zu der von den Nicht-Kapitalgesellschaften zu entrichteten veranlagten Einkommensteuer und der von den Kapitalgesellschaften zu entrichteten Körperschaftsteuer, welche im Jahr 2001 überdies dramatisch eingebrochen ist. [38] Dieser Einbruch, der nach vorläufigen Daten für das Jahr 2001 sogar zu einer Rückerstattung der Finanzämter führt (d.h. die Unternehmen erhalten mehr von Staat zurück, als sie zahlen), soll sich den ersten Steuerschätzungen zufolge auch im Jahr 2002 allenfalls in Höhe von 50 Prozent des Körperschaftsteueraufkommens des Jahres 2000 bewegen. An der zunehmend ungerechten, die Arbeitnehmer übervorteilenden Steuerpraxis wird sich also selbst nach Beginn der Steuerreform zunächst nichts gravierend ändern.
  Die Bruttolöhne der Arbeitnehmer unterliegen heute einer um 13,3 Prozent höheren Abgabenbelastung als vor dreißig Jahren. So stark sind zwischenzeitlich Lohnsteuer und Sozialbeiträge angewachsen. Es ist fraglich, ob die Politik von Rot-Grün daran etwas grundlegend ändern wird. Schon jetzt ist ein weiteres Ansteigen der Sozialbeiträge absehbar. Der Binnenmarkt läßt sich auf diese Weise jedenfalls nicht ankurbeln. Die Situation der konsumnahen Wirtschaftsbereiche, etwa des Einzelhandels (die realen Umsätze stagnieren dort seit Jahren), zeigt das Ausmaß der Misere klar und deutlich. Der Vorwurf, die Regierung Schröder betreibe, ebenso wie die Vorgängerregierung, eine im Grunde neoliberale Politik, ist nicht leichtfertig von der Hand zu weisen. Im Gegenteil, gerade auf dem Gebiet der Rentenpolitik zeigt sich exemplarisch, wie weit inzwischen die Angebotsorientierung auch bei den ehemaligen Linksparteien um sich gegriffen hat. 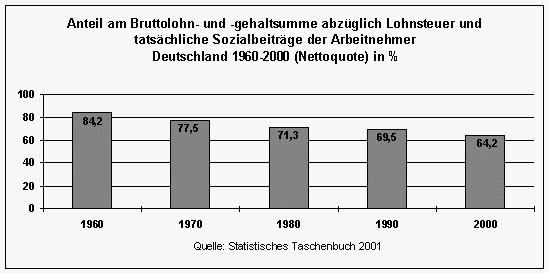 Die rot-grüne Bundesregierung hat mit der neuen Rentengesetzgebung den Rentenbezug des sogenannten Standardrentners trickreich auf 67,85 Prozent festgelegt (nach alter Berechnungsgrundlage - also ohne Trick - wären das 64,32 Prozent). Ein Vorhaben, das die heutigen Regierungsparteien beim früheren Bundesarbeitsminister, Norbert Blüm (CDU), der seinerzeit ein ähnliches Modell vorlegte (Einführung eines demographischen Faktors und Kürzung der Rente auf 64 Prozent), noch heftig kritisierten und als "sozialen Kahlschlag" gebrandmarkt haben. Allerdings war das vor dem Regierungswechsel. So schnell ändern sich manchmal die Verhältnisse. Hinzu kam bei Rot-Grün die früher ebenfalls hart bekämpfte Abkehr vom Umlageverfahren und damit einhergehend von der paritätischen, durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu gleichen Teilen beglichenen Beitragsfinanzierung. Ergebnis ist der Einstieg in das vormals verpönte private Kapitaldeckungsverfahren, an dessen Finanzierung die Arbeitgeber keinen Anteil mehr haben. [39] Norbert Blüm, der Herz-Jesu-Marxist, hätte so etwas nicht gewagt. Der politische Druck von SPD, Grünen und Gewerkschaften wäre in diesem Fall bestimmt übermächtig gewesen. Doch nun exekutiert man es selbst. In Zukunft werden die Arbeitnehmer, unterstützt durch eine staatliche Förderung, mehr Beiträge zu zahlen haben als die Arbeitgeber. Ohne diese Reform hätte der Beitragssatz den Prognosen zufolge im Jahr 2030 bei 23,9 Prozent gelegen, wovon Arbeitgeber und Arbeitnehmer jeweils 12 Prozent getragen hätten. [40] Mit der jetzigen Rentenreform wird der Beitragssatz im Jahr 2030 auf 22 Prozent festgeschrieben, davon tragen dann die Arbeitgeber 11 Prozent, die Arbeitnehmer hingegen 15 Prozent (11 Prozent gesetzliche Rentenversicherung plus 4 Prozent private "Riester-Rente"). Mit anderen Worten: Die "Riester-Rente" bewirkt für die Arbeitgeber - gegenüber dem alten Modell - eine Reduzierung um 1 Prozent, für die Arbeitnehmer bringt sie jedoch eine Erhöhung um 3 Prozent. Ob der Beitragssatz damit bis zum Jahr 2030 wirklich auf dem Niveau von 22 Prozent stabilisiert werden kann, steht allerdings in den Sternen, da die hierbei unterstellte Entwicklung des Wirtschaftswachstums und daraus resultierend die des Arbeitsmarkts schlechterdings kaum seriös vorhersagbar sind. Die Riester-Rente wird zudem in der Ansparphase die Kaufkraft, und damit die effektive Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen, weiter schmälern. Sie lenkt nämlich in nicht unerheblichem Ausmaß Kapital von den Konsummärkten zu den Anlagemärkten (ab dem Jahr 2008 4 Prozent der Bruttolöhne). Ob es da einerseits produktiv (z.B. für Investitionen) angelegt wird und andererseits entsprechend sicher ist, darf bezweifelt werden. Die Beiträge zur Riester-Rente liegen ja nicht irgendwo im Tresor herum und harren der Auszahlung. Geld muß erfahrungsgemäß arbeiten. Und ob die Unternehmen bei - durch stagnierende Reallöhne - weiterhin absehbarer Nachfrageschwäche zum Investieren geneigt sind, muß man mit Skepsis beurteilen. Die Vermögensverwalter des sich ansammelnden Kapitalstocks werden überdies den Trend zum Shareholder-value-Konzept [41], das eher an kurzfristiger Kapitalrendite denn an sozialen Gesichtspunkten orientiert ist, enorm verstärken. An einer Kapitalschwäche leiden wir ja bekanntlich nicht, es ist bloß in den falschen Händen. Die Anlagemärkte werden also in Zukunft mit erheblich mehr, nach sinnvollen (sprich rentablen) Investitionen lechzendem Kapital überschwemmt. Es steht deshalb zu befürchten, daß sich die Anlagemärkte dabei noch weiter von der realen Wirtschaft entfernen und verstärkt der riskanten Spekulation anheimfallen. Das Jammern wird groß sein, wenn sich erst einige Banken oder Versicherungen mächtig verspekulieren und dabei in die Insolvenz getrieben werden. In diesem Fall bleibt nur noch, wie in Japan bereits mehrfach vorexerziert, der Staat als letzter Rettungsanker. Dem Finanzsystem droht dort nämlich aufgrund allzu leichtfertig vergebener Kredite - in Verbindung mit den oben erwähnten Deflationerscheinungen - der Kollaps. Nachdem einige Banken zusammenbrachen und hierdurch die in einem Kapitaldeckungsverfahren angesammelten Rentenrückstellungen vieler Japaner gefährdet waren, mußte die Regierung notgedrungen als Garant auftreten. Andernfalls wäre eine erkleckliche Anzahl der Japaner im Alter vor dem absoluten Nichts gestanden. Nebenbei bemerkt: Die Kapitalrendite der japanischen Pensionsfonds tendiert dort momentan, dank der Krise des Finanzsektors, gegen Null. Hier werden zur Zeit also viele Erwartungen bitter enttäuscht. "Wer die Systeme tauscht, tauscht nur die jeweiligen Risiken. (...) Deutschland hat in den vergangenen 80 Jahren zweimal eine fast vollständige Vernichtung aller Geldvermögen erlebt. Natürlich hoffen wir alle, dass Krieg, Inflation und Börsencrash in Zukunft nicht wieder vorkommen. Aber die Geschichte ist auch international reich an Beispielen dafür, dass man mit Kapitalanlagen viel gewinnen, aber auch sehr schnell viel verlieren kann: Die Asienkrise, die Russlandkrise und die Schwierigkeiten in Lateinamerika sind die jüngsten Beispiele." [42] Dies zeigt, welche Risiken ein Kapitaldeckungsverfahren beinhalten kann. Wer außerdem meint, ein solches wäre vor den Gefahren, die uns durch die negative Entwicklung des demographischen Aufbaus der Bevölkerung drohen, gefeit, irrt gewaltig. Auch Banken und Versicherungen müssen sich auf die zunehmende Vergreisung der Gesellschaft einstellen: "Die jeweils erwerbstätige Generation [muß] stets zugunsten der Rentner auf Teile des gesamtwirtschaftlich verfügbaren Gütervolumens verzichten, und zwar unabhängig vom Finanzierungsverfahren." [43] "Der Alterungsprozess der Bevölkerung betrifft [somit] nicht nur die Umlagefinanzierung, sondern auch die Kapitalfundierung. (...) Wenn einem steigenden Anteil Älterer ("Babyboomer"), die ihren Lebensabend aus kapitalfundierten Systemen bestreiten wollen, eine zahlenmäßig immer kleinere nachwachsende Generation als Sparer und Käufer von Vermögenstiteln gegenübersteht, so hat dies Konsequenzen für den Realwert der angesammelten Vermögen." [44] Die mit Immobilien abgesicherten Vermögenswerte dürften beispielsweise bei drastisch abnehmender Bevölkerung gezwungenermaßen an Wert verlieren (die Zahl der Konsumenten wird den Prognosen zufolge bis 2050 um zirka 28 Prozent abnehmen). [45] Die bei einem Umlageverfahren eigentlich notwendigen Beitragserhöhungen respektive Leistungskürzungen werden bei einem Kapitaldeckungsverfahren also lediglich durch marktkonforme Anpassungen der Vermögenswerte abgelöst. "Bei steigender Rentnerzahl ist eine Teilauflösung erforderlich, die das Kapitalmarktangebot erhöht und den Wert des Fonds möglicherweise stark reduziert. Setzt ein größerer Entsparprozeß ein, steigt zudem die Konsumgüternachfrage an. Bei Vollbeschäftigung ergeben sich Preissteigerungen, d.h. die Erwerbstätigen werden zu einem realen Konsumverzicht über höhere Preise statt über höhere Beiträge gezwungen. Auch trägt der Inflationsprozeß zu einer weiteren Entwertung des Kapitalstocks bei. Der Übergang zum Kapitaldeckungsverfahren stellt also schon aufgrund der damit verbundenen gesamtwirtschaftlichen Risiken keine Lösung der demographisch bedingten Probleme dar und erhöht letztlich auch nicht die ökonomische Sicherheit zukünftiger Rentnergenerationen." [46] Worin am Ende, außer in der Entlastungswirkung für die Unternehmer, die Vorteile des Kapitaldeckungsverfahren gegenüber dem Umlageverfahren liegen sollen, ist angesichts dessen völlig schleierhaft. Ferner: "Die gesetzliche Rentenversicherung sichert (...) nicht nur das Einkommensrisiko im Alter ab - sie gewährt sozialen Schutz bei Invalidität und im Hinterbliebenenfall. Sie trägt den hälftigen Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag und gewährt Rehabilitationsleistungen. Zeiten der Arbeitslosigkeit und Krankheit, der Kindererziehung und der ehrenamtlichen Pflege finden im Gegensatz zur Privatversicherung rentenrechtlich Anerkennung. Der soziale Schutz der Rentenversicherung ist zudem weitgehend unabhängig vom Ausmaß des individuellen Risikos - also etwa dem Geschlecht, dem Eintrittsalter in die Versicherung, eventuellen Vorerkrankungen oder der Zahl der Familienmitglieder bzw. dem Familienstand. (...) Vor allem das Risiko einer frühzeitigen Erwerbsunfähigkeit wird unabhängig von Vorerkrankungen oder vom Alter in einem Umfang abgesichert, den zu diesen Konditionen keine Privatversicherung anbieten könnte. Denn Privatvorsorge kennt nicht nur keine Parität bei der Finanzierung, sondern auch keinen Solidarausgleich bei den Leistungen. Deshalb zählt auch das Solidarprinzip zu den Verlierern der Rentenreform 2000." [47] Es ist äußerst beschämend, daß dieser Entsolidarisierungsprozeß ausgerechnet durch eine sozialdemokratisch geführte Bundesregierung in Gang gesetzt wurde. Durch eine Partei, die sich in der Vergangenheit noch ausdrücklich zu den Grundwerten "Gerechtigkeit und Solidarität" bekannte. [48] Die andere Alternative, die Verbreiterung der Beitragsgrundlage durch die Einbeziehung anderer Einkunftsarten (also nicht nur des Erwerbseinkommens der unselbständig Beschäftigten), ließ man offensichtlich unberücksichtigt. Wären alle Einkünfte, unabhängig davon, durch wen und wo sie entstehen, in die Rentenversicherung einbezogen (Selbständige, Beamte, Miet- und Zinseinnahmen, die Wertschöpfung der Unternehmen etc.), wäre die effektive Belastung des Einzelnen - bei gleichem Leistungsumfang der Rentenversicherung - drastisch zurückgegangen, die Nettolöhne der Erwerbstätigen mithin gestiegen. Längst liegen, unabhängig vom Wahlausgang am 22. September, weitere Pläne in den Schubladen, die auch bei anderen Sozialversicherungszweigen, etwa der Krankenversicherung, Risiken zu privatisieren trachten. Unter dem Schlagwort "Eigenverantwortung" soll uns, analog zur Rentenversicherung, weiterer Sozialabbau schmackhaft gemacht werden. Konkretes hält man aber bis nach der Wahl zurück. Bedauerlicherweise hat Rot-Grün der unter sozialen Gesichtspunkten verheerenden Entwicklung, in einer ständig reicher werdenden Gesellschaft immer mehr Desintegration zu produzieren, keinen Einhalt geboten. Die Regierung Schröder ist vielmehr sehr schnell auf den unsozialen Kurs der Vorgängerregierung unter Helmut Kohl eingeschwenkt. Und, wie man am Beispiel Rentenversicherung sieht, manchmal sogar darüber hinaus. Bevölkerungsentwicklung War die Rentenversicherung wirklich in der Krise? Einerseits sind die Leistungen der Rentenversicherung in absoluten Zahlen seit 1960 zwar in der Tat immens gestiegen, andererseits sind sie jedoch in Relation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) vergleichsweise moderat angewachsen. [49] Was die Gegenwart anbelangt, kann man demzufolge nicht von einer schwerwiegenden Krise des Umlageverfahrens sprechen.
  Volkswirtschaftlich betrachtet war die Rentenversicherung bislang nicht nur äußerst stabil, sondern auf absehbare Zeit hinaus auch finanziell verkraftbar. So absurd es auf den ersten Blick klingen mag, die Rentenversicherung könnte von der Änderung des demographischen Aufbaus sogar profitieren. Sollte nämlich hierdurch die Arbeitslosigkeit drastisch sinken, was freilich unsicher ist, könnten die Beiträge für die Arbeitslosenversicherung in die Rentenversicherung umgeleitet werden. Gleichwohl tickt in unserer Gesellschaft eine Zeitbombe, an deren Entschärfung unbedingt gearbeitet werden sollte. Es ist der demographische Aufbau unserer Bevölkerung. "Während heute noch 4,4 Personen im erwerbsfähigen Alter auf eine Person im Alter von mehr als 65 Jahren entfallen (1950: 6,9 zu 1), wird sich diese Relation bis 2050 auf 1,8 zu 1 verändern. Das statistische Durchschnittsalter wird auf 55 Jahre steigen." [50] Folge einer niedrigen Geburtenrate und steigender Lebenserwartung: "Seit etwa 30 Jahren werden in Deutschland weniger Kinder geboren als zur zahlenmäßigen Nachfolge der Elterngeneration erforderlich wären. (...) Jedes Ehepaar oder in Gemeinschaft zusammenlebende Paar hat statistisch betrachtet nur 1,4 Sprösslinge. Um die vorhergegangene Generation zu ersetzen, müssten es aber 2,1 Kinder sein. (...) 1960 lag [die Lebenserwartung] noch bei 66,9 Jahren für Männer und 72,4 Jahren für Frauen. Zwanzig Jahre später waren es 70,2 und 76,9 Jahre. Inzwischen liegen die Werte bei 74,5 und 80,5 Jahren." [51]  Selbst bei einem jährlichen Zuwanderungssaldo aus dem Ausland in Höhe von 100.000 Menschen, wird die Bevölkerung in Deutschland von jetzt 82 Mio. auf 65 Mio. im Jahr 2050 sinken. Bei einem Zuwanderungssaldo von 200.000 wären es dann "bloß" 70,4 Mio. [52] "Die Bevölkerungszahl Deutschlands [kann aber] bis 2050 durch eine jährliche Nettozuwanderung (d.h. bei Abzug der Abwanderung) von 350.000 bis 500.000 Menschen gehalten werden. Der Anteil der Ausländer an der Wohnbevölkerung stiege dabei je nach der Zahl der Einbürgerungen auf 22 bis 25 Prozent." [53] Vor diesem Hintergrund ist es völlig unverständlich, warum wir uns so schwer tun, mit der deutschen Lebenslüge, wir seien kein Einwanderungsland, endlich aufzuräumen. Wir sind es de facto schon seit mehr als dreißig Jahren. Inzwischen wächst bei uns bereits die dritte Generation von Einwanderern heran. Wenn schon nicht Humanität den fremdenfeindlichen deutschen Dickschädel erweichen kann, dann doch hoffentlich die ökonomische Notwendigkeit. Wir werden durch keine noch so familienfreundliche Sozialpolitik zu einer zur Bevölkerungserhaltung ausreichenden Geburtenrate zurückkehren. Sozialverträgliche Einwanderung ist der einzig gangbare Weg. Mehr Mut beim verspätet vorgelegten Einwanderungsgesetz wäre mithin äußerst hilfreich gewesen. Doch selbst hier hat sich Rot-Grün den Schneid abkaufen lassen. Die Risiken der Bevölkerungsentwicklung hauptsächlich den Arbeitnehmern und den auf staatliche Transferleistungen angewiesenen Menschen aufzuerlegen, ist nicht nur inhuman, sondern ökonomisch betrachtet auch ein Irrweg. Es ist schlechterdings kaum vorstellbar, daß unsere Gesellschaft diesen unumgänglichen Anpassungsprozeß unbeschadet übersteht, wenn es dabei nicht wenigstens einigermaßen gerecht zugeht. Setzt sich hingegen die Strömung durch, die auf immer höhere Renditen setzt, aber ansonsten mit den "kostentreibenden" sozialen Entwicklungen in unserem Staat nichts mehr zu tun haben möchte, fliegt uns diese Gesellschaft früher oder später um die Ohren. Ob dann die Profiteure noch profitieren, sei dahingestellt. Ungeachtet seiner systemimmanenten Mängel, der Geist des "rheinischen Kapitalismus" bestand immer aus dem sozialem Ausgleich zwischen den Interessengegensätzen. Wer diesen Grundkonsens leichtfertig zerstört und eher dem angelsächsischen Modell zuneigt (Schröder/Blair-Papier), wird am Ende zwangsläufig auch dessen Nachteile, etwa die schier unerträgliche Kriminalitätsbelastung, ernten. Das Sparprogramm Es ist unbestritten: Die exorbitanten Staatsschulden müssen abgebaut werden. Aber auf welche Weise dies zu geschehen hat, darüber darf man mit Fug und Recht streiten. Ob es volkswirtschaftlich wirklich klug ist, das Haushaltsdefizit auch in einer Rezession relativ rasch auf Null zurückzuführen, muß energisch bestritten werden. John Maynard Keynes (1883 - 1946) hielt in Zeiten der Rezession eine staatliche Stimulierung der Nachfrage für angebracht, um hierdurch die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Der nach ihm benannte Keynesianismus forderte, sich konsequent antizyklisch zu verhalten. Das heißt, in der Krise durch Ausweitung der Staatsverschuldung zusätzliche Nachfrage herstellen (deficit spending), während man in der Boomphase die vorher angehäuften Schulden durch Steuererhöhungen wieder abbauen sollte. Rot-Grün verhält sich demgegenüber prozyklisch. Gerade in der Krise fährt man durch konsequentes Sparen die Nachfrage noch weiter zu zurück, weil der Staat seine Investitionen reduziert. "Der Anteil der öffentlichen Bruttoinvestitionen am Bruttoinlandsprodukt liegt 2001 nur noch bei 1,8%; 1994 lagen sie noch bei 2,7% und Mitte der 60er Jahre bei 5%." [54] Die Rezession verschärft sich folglich. Daß sich frühere Regierungen selbst in Aufschwungphasen nicht an das Gebot des Schuldenabbaus gehalten haben, darf jetzt nicht dazu führen, ohne Rücksicht auf Verluste alles kaputt zu sparen. Eine geringe, etwas hinter der Steigerungsrate des Wirtschaftswachstum zurückbleibende Ausweitung der Staatsschuld würde einerseits die Nachfrage ausweiten, andererseits aber das Ziel des Schuldenabbaus nicht gefährden. Es würde lediglich etwas länger dauern. Die Stabilitätskriterien von Maastricht [55] müssen zwar, schon allein aus Gründen der Glaubwürdigkeit, eingehalten werden. Ob das auch für das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts bis zum Jahr 2006 gilt (oder, wie kürzlich von Bundesfinanzminister Eichel versprochen, sogar bis 2004), ist zumindest umstritten. Davon jedoch abgesehen, an einer Stärkung der effektiven Nachfrage durch höhere Reallöhne führt letztlich kein Weg vorbei. Wenn der Staat krampfhaft spart, die Vermögenden in zunehmendem Maße steuerlich entlastet werden, die Konsumenten aber aufgrund stagnierender Reallöhne nicht genug Nachfrage produzieren und man außerdem die sozialen Leistungen immer weiter zurückfährt, kann die Rechnung natürlich nicht aufgehen. Ein Ausweg wäre u.a. die Einlösung diverser Wahlversprechen gewesen. Familienförderung und Alleinerziehende Versprachen die Grünen in ihrem Wahlprogramm, das Ehegattensplitting abzuschaffen [56], will man bis dato nichts mehr davon wissen. Dabei würde die Aufgabe der steuerlichen Förderung des Verheiratetseins rund 41 Mrd. DM (21 Mrd. Euro) freisetzen, die man beispielsweise zugunsten der Menschen mit Kindern umschichten könnte. [57] Erst jetzt, angesichts der verheerenden Wahlniederlage in Sachsen-Anhalt (ein Menetekel für die Bundestagswahl?), will man das Ehegattensplitting angeblich zur Disposition stellen. Im neuen Wahlprogramm der Grünen steht es jedenfalls wieder drin. [58] Darf man dem wirklich glauben? Wer einmal lügt... "Alleinerziehende verdienen die besondere Unterstützung der Gesellschaft", schwadronierte die SPD in ihrem Wahlprogramm 1998. [59] Damals waren 56 Prozent der Sozialhilfeempfänger Frauen. [60] Daran hat sich bis heute nichts geändert. Nach den neuesten Statistiken bezogen Ende 2000 rund 1 Mio. Kinder, darunter 450.000 Kinder im Alter bis sieben Jahre, finanzielle Unterstützung vom Staat. [61] Gerade für sie wollte man etwas tun. Früher war man sich einig darin, daß insbesondere die Anrechnung des Kindergeldes auf die Sozialhilfe für die prekäre Situation der Alleinerziehenden verantwortlich ist. Was hat sich daran seit der Regierungsübernahme geändert? Nun, "seit Januar 2000 kommt die verbesserte Familienförderung auch Familien zugute, die Sozialhilfe beziehen", behauptet die Regierung. "Bei einem Kind werden 10,25 Euro, bei zwei und mehr Kindern werden 20,50 Euro des Kindergeldes nicht als Einkommen angerechnet." [62] Und im neuen Wahlprogramm der Grünen heißt es dazu: "Wir haben einen Anfang bei der Entlastung von Kindern und Eltern gemacht, indem wir das Kindergeld - auch für die Kinder in Sozialhilfe - erhöht haben." [63] Und natürlich abermals das Lippenbekenntnis: "Gerade die Alleinerziehenden und ihre Kinder brauchen mehr Unterstützung durch Staat und Gesellschaft." [64] Die ganze Wahrheit ist das nicht, genaugenommen (rechnerisch) nicht einmal die halbe. Die SPD-Politikerin Antje-Marie Steen (MdB) erläutert uns warum: "Die vorgesehene Anhebung des Kindergeldes [zum 01.01.2002] wird auf die Sozialhilfe angerechnet werden. Die letzte Kindergelderhöhung von 20 DM zum 1.1.2000 wurde als anrechnungsfreies Einkommen behandelt." [65] Das heißt, lediglich die Kindergelderhöhung zum 01.01.2000 wurde nicht auf die Sozialhilfe angerechnet, die Kindergelderhöhung zum 01.01.2002 wird wieder angerechnet - wie auch das übrige Kindergeld weiterhin angerechnet wird. Vom Kindergeld, gegenwärtig 154 Euro für das erste, zweite und dritte Kind, werden lediglich 10,25 Euro bzw. 20,50 Euro NICHT auf die Sozialhilfe angerechnet. Im Umkehrschluß bedeutet das nach wie vor die Anrechnung von rund 144 Euro (für das erste Kind), d.h. es hat sich in diesem Bereich im wesentlichen nichts geändert. Für Sozialhilfeempfänger mit Kindern wird von Rot-Grün also auch künftig die vorher heftig kritisierte CDU-Politik exekutiert. Eigentlich wollte man doch mal die Armut, insbesondere die von alleinerziehenden Müttern bekämpfen. Nun, es war einmal... Man wird mit der Zeit ja so bescheiden. Antje-Marie Steen rechtfertigt das auf ihrer Homepage mit der Äußerung: "Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass das Kindergeld ebenso der Sicherung des Lebensunterhalts dient wie die Regelsätze zur Sozialhilfe. Wenn also zusätzlich zur Sozialhilfe Kindergeld gezahlt würde, würde die Existenzsicherung doppelt gewährleistet. Darüber hinaus wären sonst auch Konflikte mit dem Lohnabstandsgebot vorprogrammiert. Deshalb ist die Anrechnung der Kindergelderhöhung auf die Sozialhilfe nicht nur systematisch geboten, sondern auch gerecht." [66] Der Rechtfertigungsgrund, das ominöse Lohnabstandsgebot, ist hinreichend bekannt, der Einwand kam früher jedoch stets von der CDU/CSU/FDP-Regierung. Die Grünen hatten es einst treffend formuliert: "Sinkende Reallöhne und ein nicht ausreichender Familienlastenausgleich haben eine Schicht entstehen lassen, die trotz Erwerbsarbeit arm ist. Diesen Menschen wäre nicht damit gedient, wenn per "Lohnabstandsgebot" die Sozialleistungen auf ein noch niedrigeres, nicht mehr menschenwürdiges Niveau festgeschrieben würden; deshalb lehnen wir dies ab." [67] Gemacht haben sie allerdings nichts daraus. Wenn das das Ergebnis des Machtwechsels von 1998 ist... Fazit: Auch in bezug auf das Kindergeld für Sozialhilfeempfänger und die Hilfe für Alleinerziehende gibt es keinen Grund, im September 2002 Rot-Grün zu wählen. Es sei denn, man würde sich mit der Nichtanrechnung von 10,25 respektive 20,50 Euro zufrieden geben. Vermögensteuer Entgegen den Zusagen in den Wahlprogrammen beider Regierungsparteien verzichtete man bislang auf die Wiedereinführung der Vermögensteuer. Hier entgehen dem Staat wertvolle Steuereinnahmen (rund 4,6 Mrd. Euro), die er in anderen Bereichen sinnvoll, etwa für Investitionen, einsetzen könnte. Im Wahlprogramm der SPD hieß es noch: "Im Sinne eines gerechten Lastenausgleichs werden wir dafür sorgen, daß auch die sehr hohen Privatvermögen wieder einen gerechten Beitrag leisten (...). Dazu werden wir für eine verfassungskonforme Besteuerung dieser sehr hohen Privatvermögen sorgen." [68] Und die Grünen formulierten kurz und bündig: "BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen die Vermögensteuer in Höhe von einem Prozent wieder einführen." [69] Der haushaltspolitische Sprecher der grünen Bundestagsfraktion, Oswald Metzger, bezeichnete dann knapp ein Jahr nach der Wahl die Debatte um die Wiedereinführung der Vermögensteuer völlig überraschend als "Neiddebatte" - ein von der früheren konservativ-liberalen Bundesregierung gern verwendeter Kampfbegriff. [70] Hätte er es bloß vor der Wahl gesagt, wir hätten wenigstens gewußt, woran wir sind. "5% der Bevölkerung verfügen über 46%, also fast die Hälfte des deutschen Geldvermögens. 365.000 erwachsene Deutsche besitzen jeweils mehr als 1 Million Euro privates Geldvermögen. Im Durchschnitt verfügt jeder dieser 365.000 Reichen über rund 5,5 Millionen Euro! Die Anzahl nahm von 1996 bis 1999 um 52.000 zu, was einem Wachstum von 5,3 % pro Jahr entspricht. Deren Geldvermögen ist im Zeitraum 1996 bis 1999 mit 10% pro Jahr auf ein Gesamtvermögen von 2.000 Milliarden Euro (3.900 Milliarden DM) gestiegen (das Geldvermögen von weniger als 1 Million Euro, das Einzelne besitzen, ist dabei ausgeklammert. Ebenso ist Immobilienbesitz und Eigentum an Unternehmungen bei dieser Betrachtung nicht berücksichtigt)." [71] Auf die Besteuerung dieses Vermögens zu verzichten, ist ein unbeschreiblicher Skandal. § 116 AFG / 146 SGB III Während ich dies schreibe, streikt die IG Metall gerade für bessere Löhne. Möglicherweise kommt hierdurch eine gesetzliche Regelung zum Zuge, die 1986 von der konservativ-liberalen Vorgängerregierung in Kraft gesetzt wurde: Der § 116 AFG (Arbeitsförderungsgesetz) - jetzt § 146 SGB III (Sozialgesetzbuch III). Darin wurde die sogenannte "kalte Aussperrung" (Fernwirkung von Arbeitskämpfen) geregelt. Wörtlich heißt es darin: "Durch die Leistung von Arbeitslosengeld darf nicht in Arbeitskämpfe eingegriffen werden." § 174 SGB III regelt entsprechendes für das Kurzarbeitergeld. Wenn ein Betrieb indirekt von einem Streik betroffen ist, etwa wegen fehlender Zulieferteile, kann er Produktion und Lohnzahlung einstellen. Dessen Arbeitnehmer erhalten dann keinerlei Lohnersatzleistungen. Dies erhöht natürlich den Druck auf eine im Streik befindliche Gewerkschaft ungemein. Entweder läßt sie ihre kalt ausgesperrten Mitglieder im Regen stehen, zahlt also an die Betroffenen keine Streikgelder aus, gerät aber auf diese Art innergewerkschaftlich unter Beschuß. Oder sie muß zusehen, wie ihre Streikkasse wie Butter in der Sonne dahinschmilzt. Beides keine attraktiven Alternativen. Durch die gesetzliche Regelung in bezug auf die kalte Aussperrung ist die Waffen- und damit die Chancengleichheit im Arbeitskampf erheblich eingeschränkt. Nicht umsonst praktiziert die IG Metall gegenwärtig den "Flexi-Streik". Mit kurzen Streiks, die aber keinen Betrieb auf längere Zeit völlig stillegen werden, soll die kalte Aussperrung und damit die Anwendung des § 146 SGB III von vornherein verhindert werden. Die gewerkschaftsnahe SPD versprach im Wahlprogramm 1998, die Chancengleichheit der Tarifvertragsparteien zu sichern. Konkret: "Neufassung des § 146 Sozialgesetzbuch III." [72] So steht es geschrieben. Nach fast vier Regierungsjahren ist der perfide Streikparagraph aber immer noch in Kraft. Wenn die Gewerkschaften im Jahr 2002 durch die Anwendung des § 146 massiv betroffen sein werden, schließlich ist nicht absehbar, wie lange und wie heftig diesmal gestreikt wird, können sie sich bei ihren Genossen in Regierung und Bundestag recht herzlich bedanken. "Über Deine Haltung zur Tarifpolitik braucht man angesichts des 146 SGB III (116 AFG) nicht mehr zu reden", schrieb Walter Riester, damals noch IG Metall-Vize, dem "lieben Kollegen Blüm" (seinem Vorgänger im Amt des Bundesarbeitsministers) in einem Briefwechsel empört ins Stammbuch. [73] Ob er heute die gleiche Meßlatte an sich selbst anlegen würde? Beschimpfung der Arbeitslosen Der früheren Bundesregierung hat man wohl nicht zu Unrecht vorgeworfen, sie bekämpfe eher die Arbeitslosen anstatt die Arbeitslosigkeit. Nach dem Motto: Wenn ich mit der Armut nicht fertig werde, dann sollen es wenigstens die Armen büßen. Die Lufthoheit über den Stammtischen war der konservativ-liberalen Regierung stets gewiß, wenn mal wieder über die "soziale Hängematte" [74] oder den "kollektiven Freizeitpark Deutschland" [75] debattiert wurde. Genau in diese Kerbe haut auch Bundeskanzler Gerhard Schröder, er fordert nämlich ebenfalls ein härteres Vorgehen gegen Arbeitslose. "Es gibt kein Recht auf Faulheit in unserer Gesellschaft", belehrte uns der Chef der gewerkschaftsnahen SPD und bekam deshalb von Guido Westerwelle (FDP) artig Beifall gespendet. [76] Auch der neue Chef der Bundesanstalt für Arbeit, Florian Gerster (SPD), weiß ganz genau, wie man gegen "Sozialschmarotzer" vorgeht. Gerster schlug u.a. vor, die Höhe des Arbeitslosengeldes von der Länge der Arbeitslosigkeit abhängig zu machen. "Nach den (...) Vorstellungen Gersters könnten Arbeitslose in den ersten Wochen mehr erhalten als bisher, etwa 80 Prozent des letzten Nettolohnes. Danach solle es die Leistungen aber nur noch zeitlich begrenzt und degressiv gestaffelt geben, "bis zum Erreichen der Sozialhilfe", sagte Gerster. Das würde "die Intensität bei der Suche nach einem Job in den ersten Monaten verstärken." [77] Dies träfe dann vor allem ältere Arbeitslose, die von der Wirtschaft kaum noch eingestellt werden. Es ist der erklärte Wille der rot-grünen Regierung, die Arbeitslosenhilfe mit der Sozialhilfe zu verschmelzen. Was das konkret bedeutet, ob dann etwa auch Arbeitslosenhilfebezieher kein Recht mehr auf Arbeitsförderungsmaßnahmen des Arbeitsamts haben (Umschulungen etc.), darüber schweigt man sich geflissentlich aus. Erst mal die Wahl hinter sich bringen, danach wird man weitersehen. Wer Arbeitslose für ihre Arbeitslosigkeit selbst verantwortlich macht, hat mit Sicherheit ein falsches Verhältnis zum Sozialstaat. Bevor man Arbeitslose für die Nichtannahme von Arbeit bestraft, muß man ihnen vorher auch konkrete Stellen anbieten. Arbeitsplätze, von denen sie darüber hinaus existieren können. Der allseits angedachte Niedriglohnsektor ist diesbezüglich also keine Patentlösung für unsere Arbeitsproblematik. Außerdem ist mir kein Gesetzentwurf bekannt, der eine Bestrafung der Arbeitgeber vorsieht, wenn sie Menschen von Arbeit - wie es euphemistisch heißt - "freisetzen" (also entlassen) bzw. ihrerseits deren Einstellung ablehnen. Jede Medaille hat zwei Seiten. In puncto Arbeitslosigkeit drischt man jedoch immer nur auf die eine, und zwar stets auf die schwächere ein. Von der Union und der den Liberalen sind wir es ja gewohnt. Aber jetzt auch die SPD? Sind das die sozialdemokratischen Vorstellungen von "sozialer Partnerschaft" und einem "gerechten Anteil am gemeinsam erarbeiteten Wohlstand"? [78] Vermutlich. Oder offenbart sich hier bereits die Verzweiflung derjenigen, die aus Konzeptionsmangel mit der Arbeitslosigkeit nicht mehr fertig zu werden glauben und lieber in puren Populismus abgleiten? Tobin-Tax Der tägliche Devisenhandel lag Anfang der siebziger Jahr bei 15 Mrd. US-Dollar, im Jahr 2000 wurden an einem durchschnittlichen Tag Devisenumsätze in Höhe von über 2.100 Mrd. US-Dollar getätigt. [79] Die Umsätze an den Devisenmärkten sind also extrem gestiegen, hauptsächlich aufgrund der Devisenspekulation, nicht aufgrund realer Wirtschaftsvorgänge. Der Welthandel (Exporte) ist nämlich im gleichen Zeitraum "nur" von 312,5 Mrd. US-Dollar [80] auf 5.739,6 Mrd. US-Dollar [81] pro Jahr angewachsen. Die internationalen Devisentransaktionen waren im Jahr 2000 folglich rund 85mal so stark wie die realwirtschaftlichen Vorgänge, denen sie eigentlich zugrunde liegen sollten. Anleger machen sich schon geringe Wechselkursunterschiede zunutze, um mit kurzfristigen Kapitalbewegungen Profite zu erzielen. Folge davon ist eine Destabilisierung der Wechselkurse, mit entsprechend negativen Konsequenzen für die Weltwirtschaft. Nicht zuletzt die Asienkrise hat deutlich gemacht, wie gefährlich sich ein derartiger Spekulationsüberhang erweisen kann. Ganze Regionen können dadurch ins ökonomische Abseits geraten. Da offensichtlich weniger die Handelsströme, sondern vielmehr die kurzfristigen zins- und spekulationsbedingten internationalen Kapitalbewegungen für die Kursentwicklung der Währungen ausschlaggebend sind, entwickelte James Tobin (geb. 1918, amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, Nobelpreis 1981) eine Gegenstrategie. Er richtete sein Augenmerk auf grenzüberschreitende Spekulationsgeschäfte. Tobin empfahl eine globale Devisentransaktionssteuer - die Tobin-Tax. Sie könnte die Devisenspekulation wirksam unterbinden, denn sie macht das Ziel der Spekulanten, minimale Wechselkursschwankungen gewinnbringend auszunutzen, unrentabel und damit unattraktiv. Den internationalen Warenaustausch würde sie aufgrund ihrer geringen Höhe (0,5 Prozent) dagegen nicht behindern, ein Mittelklassewagen im Wert von 20.000 Euro würde durch die Tobin-Tax nur um 100 Euro teurer. "Wenn die Steuer ihre Lenkungsfunktion so weit erfolgreich erfüllt, dass der Devisenumsatz um die Hälfte zurückgeht, würden bei einem Steuersatz von 0,5 Prozent immer noch rund 90 Milliarden US-Dollar anfallen. Das ist etwa das Doppelte der Entwicklungshilfe aller Industrieländer zusammengenommen - eine Summe, mit der einiges Sinnvolles unternommen werden könnte, etwa in der Klimapolitik, für soziale Zwecke oder in der Entwicklungspolitik." [82] Im Wahlprogramm der Grünen stand folgerichtig: "Zur Verminderung von Spekulation wollen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eine Umsatzsteuer auf Devisengeschäfte erheben (Tobinsteuer)." [83] Und auf dem grünen "Ratschlag Außenpolitik" im Oktober 1997 hieß es: "Soziale und ökologische Standards, eine Begrenzung der Währungsspekulation etwa durch eine Tobin-Tax, sind mehr als überfällig." [84] Doch als langjähriger Anhänger der Grünen kann man sich inzwischen nur verwundert die Augen reiben. Ein paar Jahre und etliche Regierungsposten später ist die Argumentation auf einmal völlig anders. Uschi Eid, vormals entwicklungspolitische Sprecherin der Grünen und jetzt Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, verkündet neuerdings: "Die Effektivität (...) multilateraler Regulierungen darf aber nicht überschätzt werden. Zu einfach scheint es mir deshalb zu glauben, mit einer internationalen Tobin-Steuer auf Devisentransaktionen könne man Finanzmärkte kontrollieren und damit verbesserte Grundlagen für die ökonomische und soziale Entwicklung schaffen." [85] Der grüne "Erkenntnisgewinn" als Regierungspartei ist in der Tat beträchtlich. Uschi Eid, die als Oppositionspolitikerin dem damaligen CDU-Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Schäuble noch "ein langsames Austrocknen der Entwicklungspolitik" vorwarf [86] und nun selbst die Kürzung des Etats ihres Hauses um 5,3 Prozent zu verantworten hat, ist das offenbar ebenso gleichgültig wie frühere Wahlaussagen zur Tobin-Tax. Abermals werden grüne Grundsätze leichtfertig über Bord geworfen und die Wähler damit gründlich vor den Kopf gestoßen. Im grünen Wahlprogramm 2002 erlebt die Tobin-Tax übrigens eine wundersame Renaissance: "Wir wollen, dass Deutschland in Europa eine Initiative zur Einführung der Tobin-Steuer und anderer geeigneter Instrumente ergreift, um die internationalen Finanzmärkte zu regulieren und die Devisenspekulationen einzuschränken." [87] Ob die Wähler im September substanzlose Wahlrhetorik noch einmal belohnen werden? Der Krieg im Kosovo Parteiprogramme und öffentliche Verlautbarungen sind wahrlich eine Last, insbesondere wenn man sie ständig vorgehalten bekommt. Die friedenspolitischen Passagen des Grünen Wahlprogramms zur Bundestagswahl 1998 sind ja bereits legendär. Darin heißt es unmißverständlich: "Militärische Friedenserzwingung und Kampfeinsätze lehnen wir ab." [88] Und: "BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN akzeptieren nicht, daß die NATO ihre Rolle zu Lasten der UNO (...) ausweitet, um ihre eigene militärische Dominanz durchzusetzen." [89] Jürgen Trittin, damals Sprecher des Bundesvorstands, umriß noch kurz vor der Bundestagswahl seine damalige Position wie folgt: "Die Grünen stünden (...) auch für Rechtstreue, etwa bei einem möglichen Einsatz in Kosovo. Mit einem solchen Eingreifen ohne UN-Mandat würde das Völkerrecht gebrochen." [90] Eindeutiger geht es wirklich nicht. "Die Bundeswehr hat die Aufgabe der Landes- und Bündnisverteidigung und kann darüber hinaus nur im Rahmen eines UNO- oder OSZE-Mandats für Friedensmissionen (...) eingesetzt werden", lautete - vor der Bundestagswahl 1998 - eine wesentliche Forderung der SPD. [91] Außerdem: "Die Rolle der Vereinten Nationen bei der Sicherung des Friedens (...) muß gestärkt werden." [92] Konsequenterweise schlug sich folgende Passage im rot-grünen Koalitionsvertrag nieder: "Die Beteiligung deutscher Streitkräfte an Maßnahmen zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit ist an die Beachtung des Völkerrechts und des deutschen Verfassungsrechts gebunden. Die neue Bundesregierung wird sich aktiv dafür einsetzen, das Gewaltmonopol der Vereinten Nationen zu bewahren und die Rolle des Generalsekretärs der Vereinten Nationen zu stärken." [93] Die deutsche Sektion der Juristenvereinigung Ialana, die 1988 auf Initiative der späteren Justizministerin Herta Däubler-Gmelin (SPD) gegründet wurde, erläuterte der Öffentlichkeit unmißverständlich die rechtliche Situation: "Soweit Staaten (...) ohne Mandat des UN-Sicherheitsrates eigene militärische Gewalt zum Schutze (...) fremder Staatsangehöriger im Ausland (...) einsetzten, ohne hierfür die Zustimmung des betroffenen Staates zu haben, handeln sie völkerrechtswidrig." [94] Da nach Art. 25 Grundgesetz die allgemeinen Regeln des Völkerrechts Bestandteil des Bundesrechts sind und für die Bewohner des Bundesgebietes unmittelbar Rechte und Pflichten erzeugen, verstößt ein solcher Einsatz auch gegen unsere Verfassung. Am 25. Februar 1999 stimmten hingegen Koalition (SPD/Grüne) und Opposition (Union/FDP) fast geschlossen für die Selbstmandatierung der NATO und einen - hierdurch völkerrechts- bzw. verfassungswidrigen - Militäreinsatz im Kosovo. Dafür votierten 556 Abgeordnete, dagegen 42, darunter die 36 PDS-Abgeordneten. Zehn enthielten sich. [95] "Darf sich eine Staatenkoalition, wie im Kosovo-Krieg geschehen, (...) über geltendes Völkerrecht hinwegsetzen? Darf der Westen seinen eigenen politischen Wertekanon verleugnen? Darf die Bundesrepublik Deutschland ihrer Verfassung zuwiderhandeln?" fragten hierzu die Hamburger Friedensforscher Dieter S. Lutz und Reinhard Mutz in einem offenen Brief an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages. [96] Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Vielleicht noch dies: "Wir sind die Alternative zu den herkömmlichen Parteien." So lautete der erste Satz der Präambel des grünen Grundsatzprogramms aus dem Jahr 1980. Davon ist rund 20 Jahre danach leider überhaupt nichts mehr zu spüren. Die Grünen sind mittlerweile, wie alle anderen Parteien auch, vor allem an Macht und Ämtern interessiert. Die Programmatik wurde hierbei völlig in den Hintergrund gedrängt. Ich hätte mir gewünscht, die Grünen wären konsequent geblieben und hätten sich einem verfassungswidrigen Krieg im Kosovo hartnäckig verweigert. Notfalls um den Preis der Macht. Und: Im Kosovo herrscht heute, oberflächlich betrachtet, Frieden. Doch die Fassade täuscht gewaltig. Jetzt haben nämlich die Serben unter den gleichen ethnischen Diskriminierungen zu leiden, wie früher die Kosovaren. Wer in der Öffentlichkeit als Serbe erkannt wird, muß um sein Leben fürchten. In der Nacht zum 12.10.1999 wurde etwa der 38jährige Bulgare Valentin Krumov auf offener Straße in Pristina erschossen, augenscheinlich weil Kosovo-Albaner sein Bulgarisch mit Serbisch verwechselt hatten. [97] Slobodan Milosevic muß sich in Den Haag - zu Recht - vor dem "Internationalen Tribunal für Verbrechen im früheren Jugoslawien" für seine Untaten verantworten. Im Gegensatz dazu schweigen sich die Politiker über die Untaten der Kosovo-Albaner aus, und die Öffentlichkeit ist bedauerlicherweise absolut desinteressiert. Die Einseitigkeit des Westens in der Beurteilung der jugoslawischen Tragödie setzt sich also fort. Vom wirklichen Frieden, von wirklicher Demokratie, ist man dort noch meilenweit entfernt. Fazit Kaum eine deutsche Regierung hat jemals ihre Anhänger in so kurzer Zeit so maßlos frustriert, wie Rot-Grün. Gewiß, um ein geläufiges Sprichwort umzukehren, wo es Schatten gibt, ist auch Licht. Natürlich muß man das neue Betriebsverfassungsgesetz, das Rabattgesetz, die Mietrechtsreform, das Lebenspartnerschaftsgesetz, die ökologische Steuerreform und den Ausstieg aus der Kernenergie (selbst wenn er noch 30 Jahre dauert) anerkennen. Bis auf die beiden letztgenannten Punkte ist das jedoch im besten Fall Beiwerk. In den zentralen Politikfeldern, Friedens- und Sicherheitspolitik, Rentenreform, Gesundheitspolitik, Steuerreform und nicht zuletzt der Arbeitsmarktpolitik, hat Rot-Grün kläglich versagt. Erwartungen wurden enttäuscht, Versprechen gebrochen, falsche Akzente gesetzt. Beide Parteien sind seit der Regierungsübernahme unverkennbar in die Mitte des politischen Spektrums gerückt, haben dabei aber ihre Identität zumindest teilweise verloren. Die Politik von Rot-Grün ist der früheren von Schwarz-Gelb zum Verwechseln ähnlich. In der Mitte treten sich alle Parteien gegenseitig auf die Füße. Wirklich neue Impulse sind Mangelware, die Konzeptionslosigkeit nicht zu verbergen. Den Sozialdemokraten, in Umfrageergebnissen mächtig abgesackt, bleibt nur noch, sozusagen als letzter Ausweg, auf die medialen Fähigkeiten des Kanzlers zu vertrauen. Nur hier sehen sie ihre Chance, Edmund Stoiber, den Kanzlerkandidat der Union, nachhaltig in Bedrängnis zu bringen. Doch Gerhard Schröder ist ein Mann ohne Eigenschaften. Was ihm früher zum Vorteil gereichte, wird ihm jetzt zum Verhängnis. Niemand weiß, wofür er eigentlich steht. Ob der Schein nochmals triumphiert, ist höchst ungewiß. Substanzlose Blender gewinnen eben nicht immer. Die "neue Mitte" hinterläßt auf dem linken Flügel eine riesige Lücke, die zur Zeit von keiner anderen Partei geschlossen werden kann. Auch nicht von der PDS. Das politische System der Bundesrepublik ist aus den Fugen geraten. Zum ersten Mal gibt es auf der Linken keine demokratische Massenpartei, die sich als Alternative anbietet. Die Politikentwürfe der etablierten Parteien sind recht eindimensional geworden, man sehnt sich förmlich nach Oskar Lafontaine zurück. Der wußte wenigstens, wofür er stand. Edmund Stoiber verkörpert lediglich einen weiteren Aufguß altbekannter Rezepte, die für die drängenden sozialen Probleme auch keine Lösung darstellen. Die vielfältigen Versprechungen des Wahlprogramms der Union lassen das Schlimmste befürchten. Da wirft man mit Milliarden nur so um sich, ohne zu verraten, wie das Ganze finanziert werden soll. Im Zweifelsfall eh nur über weiteren Sozialabbau. Edmund Stoiber ist wahrlich alles andere als eine wählbare Alternative. Die Entscheidung ist scheinbar leicht: Entweder Rot-Grün oder Schwarz-Gelb. Gewissermaßen eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Alles in allem nicht unbedingt angenehm. Wer jetzt eine konkrete Wahlempfehlung erwartet, wird enttäuscht. Das muß jeder selbst entscheiden. Leicht ist die Sache jedenfalls nicht. Doch lassen wir uns überraschen, vielleicht ergeben sich ja aus dem Wahlergebnis neue Aussichten - und sei es nur die auf Regeneration in der Opposition. Bis dort die Glaubwürdigkeit wieder hergestellt ist, gehen bestimmt mehrere Jahre ins Land. Dazu sitzt der Schock über die rot-grüne Regierungspraxis bei den eigenen Anhängern viel zu tief. Politisch ein fast schon traumatisches Erlebnis. ---------- [1] Statistisches Taschenbuch 2001 [2] Fischer Weltalmanach 1984, Seite 526 (für 1982), Statistisches Taschenbuch 2000 (für 1998) Bruttoinlandsprodukt (BIP) = alle innerhalb der Landesgrenzen erstellten Waren und Dienstleistungen [3] Statistisches Taschenbuch 2001 (nur laufende Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen am Jahresende) [4] SPD-Wahlprogramm für die Bundestagswahl 1998, Seite 9 [5] Frankfurter Rundschau v. 11.11.1998 [6] Grün ist der Wechsel, Programm zur Bundestagswahl 98, Seite 9, 23 und 146 [7] Frankfurter Rundschau v. 07.10.1998 [8] die aktuellen Arbeitslosenzahlen im Internet bei der Bundesanstalt für Arbeit unter: http://www.arbeitsamt.de/hst/services/statistik/kurzinformation/bundesgebiet/index.html [9] Frankfurter Rundschau v. 14.09.2000 [10] Frankfurter Rundschau v. 24.04.2002 [11] die Konsumquote der USA lag 1999 um 7,3 % über der europäischen, Frankfurter Rundschau v. 22.08.2000 Konsumquote Deutschland im Jahr 2000 43 %, ver.di, Oktober 2001 [12] Artur P. Schmidt, Die amerikanische Verschuldungsmaschine, Telepolis, 19.01.2001 und Gerhard Waldherr (http://www.brandeins.de/magazin/archiv/2001/ausgabe_07/schwerpunkt/artikel6.html) [13] Conrad Schuhler, USA: Nach dem Boom, isw-report Nr. 46, März 2001 [14] Das Leistungsbilanzdefizit der USA - eine Gefahr für die Weltwirtschaft?, KfW-Beiträge zur Mittelstands- und Strukturpolitik [15] Frankfurter Rundschau v. 05.10.2000 [16] Frankfurter Rundschau v. 09.02.2000 [17] Fischer Weltalmanach 2002, Seite 243 [18] Frankfurter Rundschau v. 22.08.2000 [19] Länderbericht der Landesbank Rheinland-Pfalz, Januar 2002 [20] Globale Trends 2002, Frankfurt am Main, November 2001, Seite 276 [21] Entwicklungsländer 1998 (brutto): 2,35 Billionen US-Dollar, Fischer Weltalmanach 2002, Seite 1097 [22] Artur P. Schmidt, Die amerikanische Verschuldungsmaschine, Telepolis, 19.01.2001 [23] Information der US-Regierung im Internet unter "www.publicdebt.treas.gov/opd/opdpenny.htm" [24] Zahlenkompaß 2000, Statistisches Taschenbuch für Deutschland, Seite 98 und 127 [25] Fischer Weltalmanach 2002, Seite 182 [26] die bereinigte Lohnquote, also der am Volkseinkommen um Veränderungen der Beschäftigtenstruktur bereinigte Anteil der Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit, war 1991 in den alten Bundesländern so hoch wie zu Beginn der sechziger Jahre, in Gesamtdeutschland lag sie im Jahr 2000 nur 0,3 Prozent höher als 1991 (Statistisches Jahrbuch 2001) [27] Kapitalrendite = Zins auf das eingesetzte Kapital, Umsatzrendite = Gewinn (vor Steuern) in Prozent des Umsatzes [28] z.B. Jürgen Borchert, Wenn die Renten an der Börse erwirtschaftet werden sollen, Frankfurter Rundschau v. 10.03.2000 George Soros, Südkorea am Scheideweg, Frankfurter Rundschau v. 02.01.1998 Alan Greenspan, Die verwundeten asiatischen Tiger ziehen eine Blutspur durch die Weltwirtschaft, Frankfurter Rundschau v. 24.01.1998 Abwertungsspirale könnte Preise weltweit drücken, Frankfurter Rundschau v. 12.11.1997 Peter Temin und Hans-Joachim Voth, So fern und doch so möglich, DIE ZEIT, Wirtschaft 44/2001 Robert von Heusinger, Der Fluch des vielen Geldes, DIE ZEIT, Wirtschaft 47/2001 [29] Die japanische Situation ist anders als in den USA. Die japanischen Verbraucher besitzen zwar riesige Vermögenswerte, sind aber zur Zeit nicht dazu zu bewegen, ihr Vermögen auch auszugeben. Sie horten es. Selbst eine Zunahme des verfügbaren Einkommens führt heute nicht zu einem Anstieg der privaten Nachfrage. Daraus resultiert die japanische Nachfrageschwäche. [30] Globale Trends 2002, Frankfurt am Main, November 2001, Seite 228 [31] Frankfurter Rundschau v. 16.10.1997 [32] der durchschnittliche reale Monatsverdienst sank zwischen 1991 und 1998 von 2.250 DM auf 2.190 DM, Mannheimer Morgen v. 03.03.2001 [33] Frankfurter Rundschau v. 16.01.2002 [34] den Spitzensteuersatz von 53 % im Jahr 1998 auf 42 % im Jahr 2005, den Eingangssteuersatz im gleichen Zeitraum von 25,9 % auf 15 % [35] SPD-Wahlprogramm für die Bundestagswahl 1998, Seite 26 [36] SPD-Wahlprogramm für die Bundestagswahl 1998, Seite 27 [37] Bundesministerium der Finanzen, - Referat Presse und Information -, 14. Juli 2000 [38] Angaben 1970 - 1990: Fischer Weltalmanach 1992, Seite 335 Angaben 2000 - 2001: Datensammlung zur Steuerpolitik v. 03.12.2001 [39] Umlageverfahren = die aktuellen Rentenzahlungen werden durch die laufenden Einkommen der Beitragszahler abgedeckt Kapitaldeckungsverfahren = die zukünftigen Rentenzahlungen werden durch die Ansammlung und Verzinsung von Ersparnissen finanziert [40] Hans-Jürgen Urban, Ferne Signale aus einer untergegangenen sozialpolitischen Welt, Frankfurter Rundschau v. 18.09.2000 [41] Ausrichtung am Aktionärsinteresse [42] Franz Ruland, Frankfurter Rundschau v. 18.10.2000 [43] Wolfgang Scherf, Vortrag vom 9.12.1996 in der Vortragsreihe "Sozialstaat" der Justus-Liebig-Universität Gießen [44] Winfried Schmähl, Frankfurter Rundschau v. 08.08.2000 [45] Dieter Oberndörfer, Nur Zuwanderung sichert den Wohlstand Deutschlands, Frankfurter Rundschau v. 21.01.2002 [46] Wolfgang Scherf, Vortrag vom 9.12.1996 in der Vortragsreihe "Sozialstaat" der Justus-Liebig-Universität Gießen [47] Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, Frankfurter Rundschau v. 09.10.2000 [48] Godesberger Programm von 1959 und Grundsatzprogramm der SPD von 1989 [49] Statistisches Taschenbuch 2001, Rentenzahlungen für Arbeiter, Angestellte und Knappschaftliche Rentenversicherung (Ohne Wanderversicherungs-Ausgleichszahlungen) 1960-1990 alte Bundesländer, 1995 und 1999 Gesamtdeutschland [50] Dieter Oberndörfer, Nur Zuwanderung sichert den Wohlstand Deutschlands, Frankfurter Rundschau v. 21.01.2002 [51] Frankfurter Rundschau v. 20.07.2000 [52] Frankfurter Rundschau v. 20.07.2000 [53] Dieter Oberndörfer, Nur Zuwanderung sichert den Wohlstand Deutschlands, Frankfurter Rundschau v. 21.01.2002 [54] Wirtschaftspolitische Informationen, Ver.di Bundesvorstand, Oktober 2001 [55] Die Staatsverschuldung und das Haushaltsdefizit dürfen 60 % bzw. 3 % des BIP nicht überschreiten. [56] Grün ist der Wechsel, Programm zur Bundestagswahl 98, Seite 65 [57] Frankfurter Rundschau v. 27.04.2002 [58] Beschluss zum Vierjahresprogramm 2002 - 2006 (vorläufig), Kapitel 2, Seite 14 [59] SPD-Wahlprogramm für die Bundestagswahl 1998, Seite 45 [60] Zahlenkompass 2000, Statistisches Taschenbuch für Deutschland, Seite 65 [61] Frankfurter Rundschau v. 22.08.2001 [62] Die Bundesregierung, 23.11.2001 (http://text.bundesregierung.de/frameset/ixnavitext.jsp?nodeID=7655#abschnitt11) [63] Beschluss zum Vierjahresprogramm 2002 - 2006 (vorläufig), Kapitel 2, Seite 1 [64] Beschluss zum Vierjahresprogramm 2002 - 2006 (vorläufig), Kapitel 2, Seite 13 [65] http://home.t-online.de/home/steen.mdb/position/halbjahr2001.htm [66] http://home.t-online.de/home/steen.mdb/position/halbjahr2001.htm [67] Grün ist der Wechsel, Programm zur Bundestagswahl 98, Seite 73 [68] SPD-Wahlprogramm für die Bundestagswahl 1998, Seite 29 [69] Grün ist der Wechsel, Programm zur Bundestagswahl 98, Seite 66 [70] Frankfurter Rundschau v. 16.12.1999 [71] Wirtschaftspolitische Informationen, Ver.di Bundesvorstand, Oktober 2001 [72] SPD-Wahlprogramm für die Bundestagswahl 1998, Seite 18 [73] Frankfurter Rundschau v. 07.07.1998 [74] z.B. der ehemalige FDP-Vorsitzende Klaus Kinkel, TAZ v. 14.06.1993, oder der ehemalige CDU-Vorsitzende Wolfgang Schäuble, TAZ v. 07.10.1994 [75] Helmut Kohl, TAZ v. 23.10.1993 [76] Frankfurter Rundschau v. 07.04.2001 [77] Frankfurter Rundschau v. 02.04.2002 [78] SPD-Wahlprogramm für die Bundestagswahl 1998, Seite 11 [79] Fischer Weltalmanach 2002, Seite 1093 [80] Fischer Weltalmanach 1972, Seite 334 [81] Fischer Weltalmanach 2002, Seite 1216 [82] Peter Wahl (Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung, WEED), TAZ v. 29.1.2001 [83] Grün ist der Wechsel, Programm zur Bundestagswahl 98, Seite 68 [84] Frankfurter Rundschau v. 21.10.1997 [85] Frankfurter Rundschau v. 27.08.2001 [86] Frankfurter Rundschau v. 16.01.1998 [87] Beschluss zum Vierjahresprogramm 2002 - 2006 (vorläufig), Kapitel 4, Seite 4 [88] Grün ist der Wechsel, Programm zur Bundestagswahl 98, Seite 135 [89] Grün ist der Wechsel, Programm zur Bundestagswahl 98, Seite 142 [90] Frankfurter Rundschau v. 01.09.1998 [91] SPD-Wahlprogramm für die Bundestagswahl 1998, Seite 76 [92] SPD-Wahlprogramm für die Bundestagswahl 1998, Seite 77 [93] Aufbruch und Erneuerung - Deutschlands Weg ins 21. Jahrhundert, Koalitionsvertrag SPD/Grüne, Bonn, 20. Oktober 1998 [94] Frankfurter Rundschau v. 15.10.1998 [95] Frankfurter Rundschau v. 26.02.1999 [96] Frankfurter Rundschau v. 24.03.2001 [97] Jürgen Elsässer, Kriegsverbrechen, Hamburg 2000, Seite 144 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
