
| Home | Archiv
| Impressum 08. August 2004, von Michael Schöfer Was sind Gutachten eigentlich wert? "Im Verlauf des Jahres 2001 wird sich der Aufschwung festigen und an Breite gewinnen: Die Binnennachfrage, getragen von einer lebhaften Investitionstätigkeit und anziehenden Konsumausgaben, wird den Export als konjunkturelle Antriebskraft ablösen." [1] Da muß man sich in der Tat kräftig die Augen reiben, denn so beurteilte vor noch nicht allzu langer Zeit der "Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung" die Aussichten für das Jahr 2001. Erfrischend optimistisch zwar, aber - wie sich am Ende herausgestellt hat - abseits jeglicher Realität. In Wahrheit brach nämlich die Wirtschaft im Jahr 2001 mächtig ein, entgegen den prognostizierten 2,8 Prozent konnten lediglich 0,8 % realisiert werden (vgl. Tabelle). Und abweichend von der Vorhersage erwirtschaftete man im Außenhandel mit einem Exportüberschuß von 96,3 Mrd. Euro sogar einen Rekordertrag. Im Jahr zuvor hatte der Überschuß 58,8 Mrd. betragen, er ist demzufolge allein im Jahr 2001 um bemerkenswerte 63,8 Prozent gestiegen. [2] Für den Sachverständigenrat kam das offenbar völlig überraschend. Die deutsche Wirtschaft hatte indes ausgerechnet unter dem vom Sachverständigenrat nicht vorhergesehenen Einbruch der Binnennachfrage zu leiden. Es kam somit alles anders, als er vorher prognostizierte.
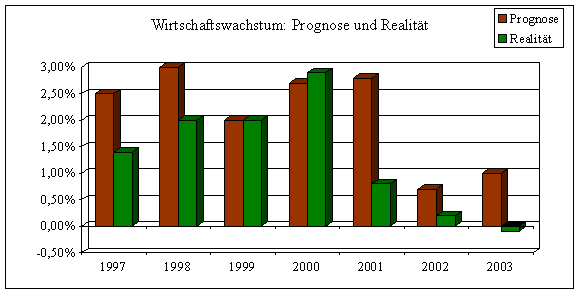 Zwischen 1997 und 2003 hat der Sachverständigenrat mit seinen Prognosen im Grunde nur in den Jahren 1999 und 2000 richtig gelegen, ansonsten hat er offensichtlich kräftig im Nebel herumgestochert. In diesem Zeitraum wurde ein Wachstum von insgesamt 14,7 Prozent vorhergesagt, erreicht wurden freilich nur 9,2 Prozent - eine Differenz von 5,5 Prozent. Legt man das aktuelle Bruttoinlandsprodukt (2003 nominal 2.130 Mrd. Euro) zugrunde, summiert sich diese Lücke auf 117 Mrd. Euro, das ist ungefähr die Hälfte des gesamten Bundeshaushalts. So reiht sich ein Prognose-Gau an den anderen. Doch die Wirtschaftsweisen sind keineswegs die einzigen, denen eklatante Fehlprognosen unterlaufen. "Die Talfahrt der Konjunktur scheint beendet. (...) Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Konjunktur noch weiter eintrüben könnte, sei derzeit eher gering", meldete frohgemut die Deutsche Bundesbank Anfang 2002. [5] Andere Auguren äußerten sich ähnlich: "Die deutsche Wirtschaft hat das Stimmungstief überwunden und steuert nach Einschätzung des Münchner Ifo-Instituts auf einen Aufschwung zu. (...) Nach der Talsohle im ersten Quartal geht die Erholung weiter, sagte Ifo-Konjunkturexperte Gernot Nerb." Ifo-Chef Hans-Werner Sinn jubelte: "Der Aufschwung ist unterwegs, das Wachstum wird sich in der zweiten Jahreshälfte beschleunigen." [6] Die Realität sah freilich ganz anders aus, im Jahr 2002 stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nur noch um mickrige 0,2 Prozent. Weder wurde die Talfahrt der Konjunktur beendet noch hat sich der vorausgesagte Aufschwung eingestellt. Das ganze Procedere wiederholte sich in der Beurteilung der Aussichten für das Jahr 2003: "Wir haben die Trendwende eingeleitet", verkündete der damalige Bundeswirtschaftsminister Werner Müller und sagte ein Wachstum von 2,5 bis 3 Prozent voraus. [7] Andere professionelle Optimisten legen fast übereinstimmende Zahlen vor: Die deutsche Wirtschaft sei besser als ihr Ruf. "Getragen von der hohen internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen wird sie 2003 um 2,3 Prozent wachsen. Inzwischen faßt die Nachfrage wieder Tritt", versicherte Klaus Friedrich, Chefvolkswirt der Dresdner Bank. Und: "Deutschland kommt sehr kräftig aus den Startlöchern." [8] Man fragt sich, auf welchem Stern diese Herren eigentlich leben, denn im Jahr 2003 legte die deutsche Wirtschaft mit einem Minus von 0,1 Prozent eine glatte Bauchlandung hin. So ist es immer, der Aufschwung steht fortwährend unmittelbar vor der Tür. Spätestens im dritten Quartal des nächsten Jahres, heißt es ständig, wird er kommen. Aber der Aufschwung bleibt in den letzten Jahren ebenso regelmäßig aus, wie er prophezeit wird. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) beispielsweise, der Club der 30 führenden Industriestaaten [9], rechnet hierzulande im laufenden Jahr (2004) mit einem Wachstum von bis zu 2 Prozent, im nächsten Jahr (2005) werden sogar deutlich mehr für möglich gehalten. Natürlich stellt man der Agenda 2010 flugs noch ein positives Zeugnis aus, die Reformen gingen angeblich in die "richtige Richtung". Voraussichtlich, so die OECD, werden sich dadurch die "Arbeitsmarktergebnisse sowie die Unternehmensdynamik auf mittlere Sicht" verbessern. Die bisherigen Reformen reichen aber laut OECD noch nicht aus und müssen dringend "weitergeführt und vertieft" werden, heißt es im 120-seitigen OECD-Gutachten. Als überfällige Reformschritte werden u.a. die "Lockerung des Kündigungsschutzes" und "mehr Lohndifferenzierung" angemahnt. [10] Die üblichen Forderungen aus dem neoliberalen Nähkästchen. Das Gutachten der OECD ist vergleichsweise dünn, die Jahresgutachten des Sachverständigenrates haben dagegen einen Umfang von mehreren hundert Seiten, das aktuelle etwa mehr als 600. Kiloweise Empfehlungen, Daten und Vorhersagen. Doch wenn letztere fast durchgehend neben der Realität liegen, könnte es nicht daran liegen, daß man die falschen Rezepte empfiehlt? Die Empfehlungen der OECD entsprechen zum Beispiel im großen und ganzen der gegenwärtigen Berliner Regierungspolitik, die sich dadurch natürlich bestätigt sieht, und den noch weitergehenden Forderungen der Opposition: Sparen auf Kosten der mittleren und unteren Einkommensschichten, Umverteilung von unten nach oben, Sozialabbau und das Abdrängen von etlichen Millionen in die Armut (Hartz IV). Darauf läuft es in der Konsequenz hinaus, und diesen Trend registrieren wir nun schon seit Anfang der 80er Jahre. Die nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik ist längst out, das Feld beherrscht nahezu unangefochten die angebotsorientierte. Doch hat uns das wirklich weitergeholfen? Offenbar nicht. In der Naturwissenschaft wird eine Theorie erst dann akzeptiert, wenn ihre Voraussagen mit den Beobachtungen weitgehend übereinstimmen. Seltsamerweise ist das in der Ökonomie völlig anders. Hier hält man krampfhaft an Theorien fest, die von der Realität längst widerlegt wurden. Hier meint man den Aufschwung herbeisparen oder zumindest - unabhängig von den geltenden ökonomischen Rahmenbedingungen - herbeireden zu können. Hier zieht man den Konsumenten das Geld aus der Tasche und wundert sich später über den flauen Binnenmarkt. Hier schwadroniert man von einer "lebhaften Investitionstätigkeit" und von "anziehenden Konsumausgaben", während man die Lohneinkommen (= das gesamtwirtschaftliche Nachfragepotential) peu a peu verringert. In der Naturwissenschaft hätte eine derart miserable Theorie keine Chance. Insofern ist der Wert der oben genannten Gutachten äußerst fragwürdig. Bedauerlicherweise übernehmen Wissenschaftler, die an der politischen Willensbildung mitwirken, die politischen Gesichtspunkte der Verantwortlichen und beginnen, die Fakten entsprechend den Überzeugungen der Verantwortlichen umzudeuten. Mit anderen Worten: Es zählt nicht das, was ist, sondern das, was eine einflußreiche Minderheit aus eigensüchtigen Gründen für wünschenswert hält. Dieses Verdikt des Ökonomienobelpreisträgers Joseph Stiglitz [11] ist leider eine absolut zutreffende Charakterisierung der herrschenden Verhältnisse. Wer die Prognosen des Sachverständigenrates mit den tatsächlichen Ergebnissen vergleicht, muß dem unumwunden zustimmen. Es wird Zeit, die Theorie den Fakten anzupassen. ---------- [1] Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Jahresgutachten 2000/2001 [2] Deutsche Bundesbank, Wirtschaftszahlen Stand 09.07.2004, Außenhandel Gesamtübersicht [3] Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Prognose 1997/1998: Frankfurter Rundschau vom 15.11.1997 Prognose 1999: Frankfurter Rundschau vom 19.11.1998 Prognosen 2000-2004: Jahresgutachten 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 [4] 1997-2003: Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung vom 15.01.2004 [5] Frankfurter Rundschau vom 21.02.2002 [6] Frankfurter Rundschau vom 28.05.2002 [7] Frankfurter Rundschau vom 01.06.2002 [8] Frankfurter Rundschau vom 16.04.2002 [9] Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Korea, Luxemburg, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Vereinigten Staaten von Amerika. [10] Frankfurter Rundschau vom 06.08.2004 [11] Joseph Stiglitz, Die Schatten der Globalisierung, München 2004, Seite 8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
