
| Home | Archiv
| Impressum 09. Oktober 2005, von Michael Schöfer Afrika und das Erbe des Kolonialismus "Südafrika enteignet weiße Farmer", titelte Der Standard am 05.10.2005. Als erste Farm, die gegen Entschädigung enteignet werden soll, nannte die Regierung eine 500 Hektar große Farm 200 km westlich von Johannesburg. Die Landkommission bot Rinderfarmer Hannes Visser umgerechnet 225.000 Euro, dieser forderte jedoch 385.000 Euro. Nachdem keine Einigung zustande kam, kündigte die Regierung nun an, sie werde Vissers Farm zwangsweise erwerben. Visser will sich vor Gericht gegen die Enteignung zur Wehr zu setzen. Inzwischen wurden weitere fünf Farmen, die in Besitz von Weißen sind, für die Enteignung vorgemerkt. "Südafrikas Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2015 rund 30 Prozent des Farmlands in schwarzen Besitz zu überführen." Auch im Nachbarland Namibia kam es kürzlich zur ersten Enteignung einer weißen Farmerin. 25 weiteren, meist deutschstämmigen Farmern ist bereits die Drohung einer Enteignung zugestellt worden. Innerhalb von 14 Tagen sollen sie der Regierung ein Verkaufsangebot unterbreiten, sonst seien die Farmen weg, hieß es. "4.000 Farmen Namibias sind in weißer Hand - und damit 80 Prozent des kommerziellen Farmlands. Ein Drittel davon gehört den Nachfahren deutscher Siedler, der Rest Buren aus Südafrika." Sorgen machen den Farmern Äußerungen von Präsident Samuel Nujoma, der von "kriminellen Farmern" spricht, die "den vollen Zorn des Gesetzes" spüren würden. [1] Als das Apartheid-Regime im Jahr 1994 zusammenbrach, befanden sich in Südafrika 87 Prozent des Farmlandes in weißem Besitz. [2] Von den gegenwärtig 46.000 kommerziellen Landwirten sind 99 Prozent Weiße, die nach wie vor drei Viertel der fruchtbaren Acker- und Weidefläche (etwa 100 Mio. Hektar) ihr eigen nennen. Verwunderung verursachte vor allem eine Äußerung von Vizepräsidentin Phumzile Mlambo-Ngcuka, der die Bemerkung herausrutschte, man müsse in punkto Landenteignung "von Simbabwe lernen". Die Stellvertreterin Thabo Mbekis fügte noch hinzu: "Angebot und Nachfrage sind keine heilige Kuh." [3] Mit anderen Worten: Die Regierung Südafrikas beabsichtigt, sich beim Farmkauf künftig nicht mehr an den aus ihrer Sicht überhöhten Marktpreisen zu orientieren. Der Hinweis auf Simbabwe verursachte mit Recht erhebliche Unruhe. Von den ehemals 6.000 weißen Farmern existieren dort nur noch 500 - mit gravierenden Folgen für die Wirtschaft. Präsident Robert Mugabe hat sein Land durch seinen autokratischen Führungsstil systematisch heruntergewirtschaftet. Im Mittelpunkt stand dabei die Enteignung der weißen Farmer. Mittlerweile steht Simbabwe vor dem Bankrott. "Der Weltwährungsfonds veröffentlichte einen Bericht zur Wirtschaftslage des Krisenstaats im Süden Afrikas, in dem vor einem bevorstehenden Kollaps Simbabwes gewarnt wird. Nachdem die Ökonomie des Landes in den vergangenen fünf Jahren bereits um fast 30 Prozent schrumpfte, sei auch in diesem Jahr ein "negatives Wachstum" von rund sieben Prozent zu erwarten, prognostizieren die Ökonomen. Die Inflation werde bis zum Jahresende auf Werte von über 400 Prozent klettern. Die Direktoren des Währungsfonds zeigten sich "zutiefst besorgt": "Ohne eine mutige politische Kurskorrektur werden die Aussichten für Simbabwe finster sein." [4] 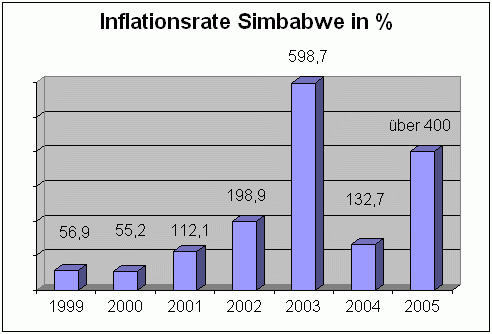 Die Regierungen des südlichen Afrikas stehen unter erheblichem Druck. Seit dem Ende der weißen Hegemonie hat sich bei der Landverteilung nichts grundlegend geändert, nach wie vor dominiert die ehemalige Herrscherschicht die Landwirtschaft. Mit einer Ausnahme: Simbabwe. Doch dort wurde die Landfrage mit einer für das Land absolut verheerenden Konsequenz "gelöst". Einerseits erwartet die farbige Bevölkerungsmehrheit völlig zu Recht endlich eine Änderung bei der noch aus der Kolonialzeit herrührenden Landverteilung. Andererseits dürfen die Regierungen bei der erforderlichen Reform nicht die landwirtschaftliche Basis zerstören. In Simbabwe ist etwa der für den Export wichtige Anbau von Tabak nahezu zum Erliegen gekommen. Zugegebenermaßen eine Zwickmühle. Doch zeigt gerade die Politik Robert Mugabes, wie man es nicht machen sollte. Den Regierungen in Südafrika und Namibia wird nicht anderes übrigbleiben, als bei der Umverteilung behutsam und systematisch vorzugehen, denn allein mit einem Wechsel der Besitzverhältnisse ist es ja nicht getan. Wie sich nämlich gezeigt hat, fehlen den neuen Landbesitzern häufig die notwendigen Kenntnisse, um die übernommenen Farmen erfolgreich weiterzuführen. Das Erbe des Kolonialismus wird die afrikanischen Staaten also noch länger belasten. Es ist nachvollziehbar, wenn viele - insbesondere die Armen - hierbei die Geduld verlieren, gleichwohl gibt es keine Alternative. Das Schicksal Simbabwes müßte als Abschreckung vollauf genügen. ---------- [1] Stern vom 13.08.2005 [2] Allgemeine Zeitung Windhoek, Namibia vom 29.09.2005 [3] Die Welt vom 29.09.2005 [4] Frankfurter Rundschau vom 06.10.2005 |
