
| Home | Archiv
| Impressum 17. November 2005, von Michael Schöfer Im Westen nichts Neues Politik ist ein schmutziges Geschäft, leider ist das keine grundlegend neue Erkenntnis. Und daß im Kampf um die Macht die Fronten zuweilen rascher wechseln als das Wetter, ist ebenfalls hinlänglich bekannt. Wir erleben gerade einen derartigen Frontwechsel. Bedingt durch das Ergebnis der Bundestagswahl vom 18. September, das den Parteien unklare Mehrheitsverhältnisse bescherte, wurden aus ehemaligen Widersachern gezwungenermaßen Freunde. Die, die sich vorher spinnefeind gegenüberstanden, müssen jetzt nämlich gemeinsam eine Regierung bilden. Die Koalitionäre haben in der kurzen Zeit seit der Wahl erstaunlich schnell dazugelernt. Doch dabei wechseln die Argumente in einem Tempo, das den Wähler schwindlig macht. Schwarz-Rot wird für das Jahr 2006 einen verfassungswidrigen Haushalt vorlegen. Das steht fest. Verfassungswidrig ist der Haushaltsentwurf deshalb, weil die Nettoneuverschuldung (ca. 41 Mrd. Euro) höher ist als die Investitionen (rund 23 Mrd. Euro). Unser Grundgesetz gebietet in Artikel 115 Abs. 1 unmißverständlich: "Die Einnahmen aus Krediten dürfen die Summe der im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben für Investitionen nicht überschreiten; Ausnahmen sind nur zulässig zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts." Die Schulden übersteigen die Investitionen nicht zum ersten Mal, sondern im Jahr 2006 bereits das fünfte Mal in Folge (vgl. Grafik). 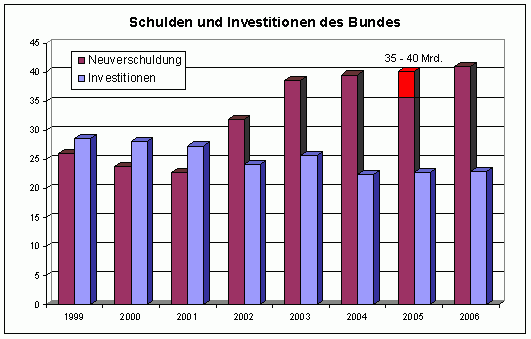 Vor der Bundestagswahl hat die Union den Sozialdemokraten und den Grünen kontinuierlich unterstellt, einen verfassungswidrigen Haushalt vorzulegen. Rot-Grün konterte diesen Vorwurf, indem sie eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts festgestellten. Somit waren die von der damaligen Opposition beanstandeten Haushaltsentwürfe de jure verfassungskonform. Jetzt will die Union unter ihrer Federführung auf einmal einen Haushaltsentwurf vorlegen, bei dem die Schulden ebenfalls die Investitionen übersteigen. Doch die Union weigert sich beharrlich, dabei eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts festzustellen. Dies wäre ein offenkundiger Verstoß gegen die Verfassung. Etwas, wofür sie Hans Eichel, den scheidenden Bundesfinanzminister, in der Vergangenheit sicherlich unter großem Getöse vor das Verfassungsgericht gezerrt hätte. Nun tut es die Union selbst. Daß dies ein klarer Rechtsbruch ist, nimmt sie billigend in Kauf. Aber es kommt noch toller. Hatte die Union früher die wirtschaftlichen Verhältnisse in den dunkelsten Farben gemalt und Deutschland konsequent mies gemacht, stellt sie heute lapidar fest, es könne keine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts vorliegen, wenn das Wirtschaftswachstum 1,6 Prozent betrage und die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse zunehme. So argumentiert neuerdings der haushaltspolitische Sprecher der Union, Steffen Kampeter. [1] Zwar hat die Union im September angesichts der allzu positiven Schlußbilanz von Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement ("Die Arbeitslosigkeit sinkt deutlich") noch zutreffend darauf hingewiesen, daß die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse nach wie vor abnehmen, doch macht diese erstaunliche Pirouette Kampeters den Kohl nun auch nicht mehr fett. Man argumentiert eben, wie man es gerade braucht. Der geneigte Beobachter fragt sich zu Recht, warum bei positivem Wirtschaftswachstum, mäßiger Inflationsrate, Rekordgewinnen der Großindustrie und riesigen Außenhandelsüberschüssen überhaupt das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht gestört sein soll. In der Tat kann von einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts nicht gesprochen werden. Was vielmehr aus dem Gleichgewicht geraten ist, sind die öffentlichen Haushalte und die Situation am Arbeitsmarkt. Das ist jedoch ausschließlich auf die Steuersenkungsorgien der letzten Jahrzehnte zurückzuführen, die vor allem die Kapitalgesellschaften und die Besserverdienenden entlastet haben. Außerdem finanzierte man die deutsche Einheit hauptsächlich über das Sozialsystem, was die Lohnnebenkosten in die Höhe trieb und den Faktor Arbeit verteuerte. Die Politiker wollten die daraus resultierenden Haushaltslücken mit einer prozyklischen Austeritätspolitik (strenges Sparen mitten im Abschwung) in den Griff bekommen, was die Notlage aber nur noch weiter verschärfte. Weitere Rotstiftaktionen waren die logische Folge. Eine positive Rückkopplung mit negativen Auswirkungen. Hinzu kam zu alledem eine Politik der Lohnzurückhaltung, die die Binnennachfrage nachhaltig abwürgte. 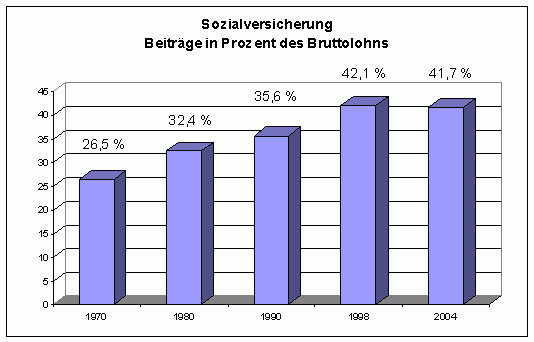 Mit anderen Worten: Die, die heute über die vermeintliche Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts streiten, haben die Notlage durch ihre verfehlte Politik selbst verursacht. Doch sie lernen nicht dazu. Die SPD, die noch vor kurzem eine zweiprozentige Mehrwertsteuererhöhung vehement ablehnte ("Merkelsteuer"), sagt jetzt überraschend ja zu einer dreiprozentigen Erhöhung ab 2007. Die Union wiederum, die im Wahlkampf zwar eine Mehrwertsteuererhöhung angekündigt hat, allerdings ausschließlich zur Senkung der Lohnnebenkosten, will nun zwei Drittel des daraus gewonnenen Finanzvolumens in die Haushaltssanierung fließen lassen. Beim Arbeitslosengeld II sollen 4 Mrd. Euro gespart werden. Die SPD, die kurz vor der Wahl demonstrativ das Soziale wiederentdeckte, feiert die "Reichensteuer", die aber nur 1,2 Mrd. Euro bringt, als gerechten Ausgleich. Können die nicht rechnen? Zwar sollen einerseits die Lohnnebenkosten um 1,6 Prozent sinken (freilich kommen den Arbeitnehmern wegen der paritätischen Beitragsfinanzierung nur magere 0,8 Prozent zugute), andererseits reduziert die Mehrwertsteuererhöhung die Kaufkraft der Konsumenten nicht unerheblich. Insgesamt steht zu befürchten, daß sich dadurch die Binnennachfrage abermals verringert. Dabei war im Wahlkampf eine Stärkung der Binnennachfrage noch erklärtes Ziel beider Parteien, im Ergebnis ist davon allerdings kaum etwas übrig geblieben. Lippenbekenntnisse. Angeblich haben sich beide bei den Koalitionsverhandlungen gegen den jeweils anderen durchgesetzt. Man reibt sich verwundert die Augen. Schwarz-Rot hofft inständig auf einen erhöhten Konsum im Jahr 2006. Ja, wovon denn? Von sinkenden Reallöhnen? Von bestenfalls stagnierender Arbeitslosigkeit? Das Prinzip Hoffnung dokumentiert die Ratlosigkeit der Regierenden. Und meistens hofft man vergebens. Im Westen also nichts Neues. Die Therapie bleibt die gleiche. Es wird lediglich die Dosis erhöht. Daß die Medizin Gift für die Volkswirtschaft sein könnte, wird erst gar nicht in Erwägung gezogen. Der Kurs sei, man höre und staune, "ohne Alternative". Das kennen wir nun schon zur Genüge. Die Folgen auch. ---------- [1] Frankfurter Rundschau vom 17.11.2005 |
