
| Home
| Archiv
| Impressum 17. Februar 2006, von Michael Schöfer Der eigentliche Kraftakt steht noch bevor Bund und Länder haben sich endlich auf eine Föderalismusreform geeinigt, melden heute die Zeitungen. So werden etwa im Bereich der Umweltgesetzgebung, bei den Hochschulen oder der Beamtenbesoldung die Zuständigkeiten des Bundes und der Länder entflochten. Die Zustimmungsrechte der Bundesländer reduzieren sich von jetzt 70 Prozent auf künftig 30 bis 40 Prozent. Politiker feiern das als "größte Verfassungsreform seit 1949" und "wuchtigen Schritt" für mehr Reformfähigkeit in Deutschland. [1] Von der Anzahl der dann im Bundesrat nicht mehr zustimmungspflichtigen Gesetze her wirkt der jetzige Kompromiß in der Tat als großer Wurf, doch ist das im Grunde Augenwischerei. Der eigentliche Kraftakt steht nämlich noch bevor. Erst in einem zweiten Schritt will man sich an die viel heikleren Finanzbeziehungen des Bundes und der Länder wagen. Aber gerade hier werden sich die Parteien noch viel schwerer auf einen Kompromiß einigen können. Als Helmut Kohl Bundeskanzler einer schwarz-gelben Koalition war, hat die SPD ihre Blockademehrheit im Bundesrat virtuos zu nutzen gewußt und zahlreiche Bestandteile des seinerzeit von Theo Waigel vorgelegten Haushaltsentwurfs verhindert. Umgekehrt hat die CDU nach dem Machtwechsel in Berlin die Regierung Schröder im Bundesrat mit der gleichen Taktik ebenfalls mächtig gepiesackt. Deshalb wird man die Länderfürsten, gleich welcher Couleur, wohl nur sehr schwer dazu bewegen können, in Zukunft auf diese Einflußmöglichkeiten zu verzichten. Die Gefahr, das politische Gewicht der Länder schwände auf Bundesebene andernfalls bis zur Bedeutungslosigkeit, ist viel zu groß. Roland Koch würde gelangweilt in der hessischen Staatskanzlei herumlungern, Edmund Stoibers krachlederne Zwischenrufe blieben in Berlin nahezu unbeachtet. Eigentlich unvorstellbar. Natürlich wäre eine Entflechtung der Zustimmungsrechte in den Finanzbeziehungen für das Gemeinwesen von großem Vorteil, da sich hierdurch entgegengesetzte Mehrheiten im Bundestag und der Länderkammer nicht mehr gegenseitig blockieren könnten. Doch ob Politiker ihre Macht tatsächlich zugunsten des Allgemeinwohls zurückschrauben, muß abgewartet werden. Bislang dominierten jedenfalls meist Partikularinteressen. Außerdem steckt der Teufel im Detail. Die komplexen Finanzbeziehungen sind sozusagen der Gordische Knoten des deutschen Föderalismus: angesichts der möglichen Auswirkungen auf alle Beteiligten äußerst schwer zu entwirren. Per Saldo wird keiner auf Einnahmen verzichten können respektive wollen, negative Folgen auf manche Haushalte von Bund, Länder und Kommunen sind freilich nicht auszuschließen. Notwendig wäre der große Wurf, der wiederum in der Politik recht selten gelingt. Inwieweit man darüber hinaus die Gliederung der Länder selbst zur Disposition stellt, steht in den Sternen. Ob man in der Bundesrepublik wirklich 16 Bundesländer braucht, darf mit Recht bezweifelt werden. Stadtstaaten wie Hamburg oder Bremen mögen ihre Existenz zwar mit der Tradition rechtfertigen, chronisch defizitäre Länder wie das Saarland ebenfalls auf historische Gesichtspunkte verweisen, gleichwohl dürften größere Zusammenfassungen in der heutigen Zeit sinnvoller sein. Vermutlich wird man hier allerdings auf Granit beißen. Das Beharrungsvermögen der Verwaltung, die sich in einem Fusionsprozeß schließlich selbst zurückstutzen müßte, ist gewaltig. Zudem sind Mehrheiten in der Bevölkerung, siehe etwa das Beispiel Berlin-Brandenburg, völlig ungewiß. Saarländer und Pfälzer in einem Bundesland zusammenzufassen, setzen viele Betroffene beinahe mit Blasphemie auf eine Stufe. Andernorts wird der Provinzialismus genauso gepflegt. Lästig, aber für Politiker, die wiedergewählt werden wollen, nicht zu vernachlässigen. 
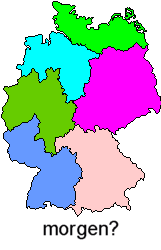 Nichtsdestotrotz sind die Chancen für eine umfassende Reform des Föderalismus besser denn je. Notgedrungen müssen in Berlin die beiden Volksparteien gemeinsam regieren, von daher ist der Gegenwind für ein solches Unterfangen vergleichsweise gering. Bei jeder anderen Konstellation wäre er wesentlich größer und dadurch schier unüberwindlich. Wenn es folglich überhaupt eine Chance gibt, dann jetzt. Mal sehen, was die Großkoalitionäre daraus machen. ---------- [1] Frankfurter Rundschau vom 16.02.2006 |
