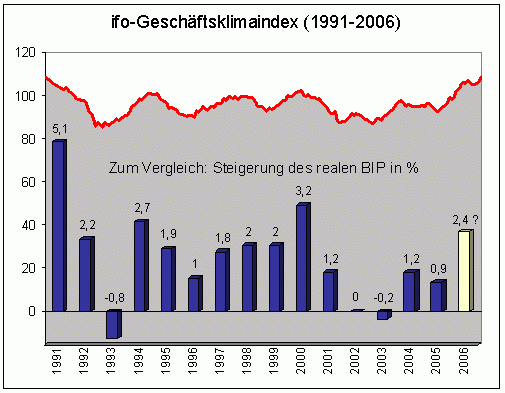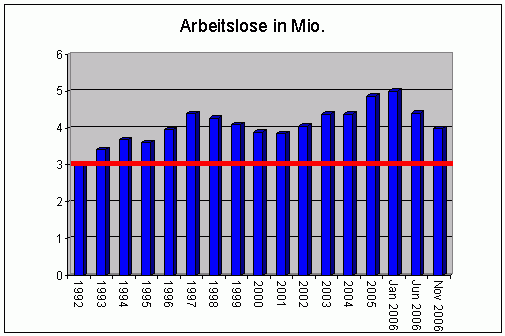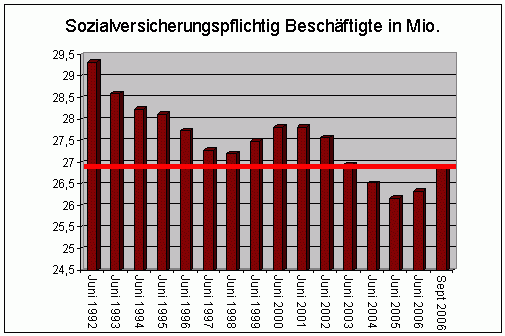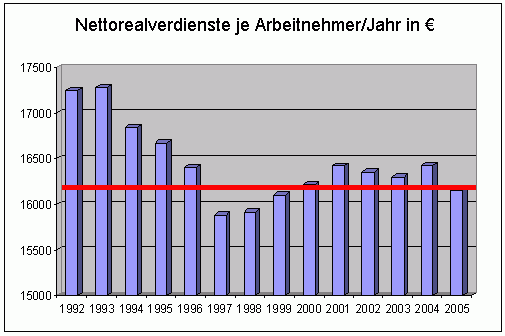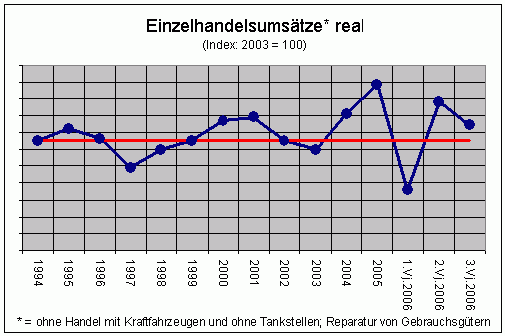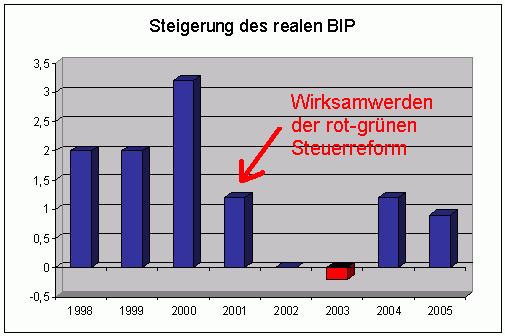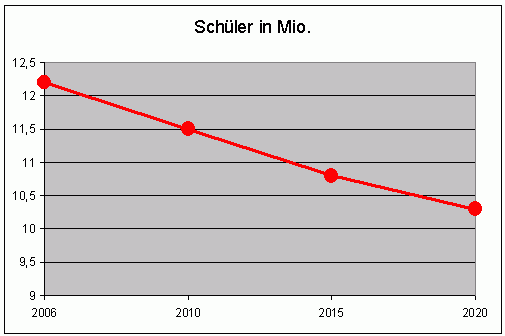|
Home | Archiv
| Impressum
01. Januar 2007, von
Michael Schöfer
Das Experiment
"Vorhersagen sind außerordentlich schwer, vor allem solche
über die Zukunft", schrieb uns einst der dänische Physiker
Niels Bohr hinter die Ohren. Dies gilt heutzutage insbesondere
für den Bereich der Wirtschaft. Die Experten sind sich
momentan nämlich nur in einem einig - in ihrer Uneinigkeit.
Die einen sind angesichts des überraschend guten
Konjunkturverlaufs euphorischer denn je. Der Aufschwung werde
nicht nur im nächsten Jahr, sondern mindestens bis 2008
andauern, behaupten sie wagemutig. Die anderen sind wesentlich
skeptischer und halten die ab Januar 2007 in Kraft tretende
Mehrwertsteuererhöhung für extrem konjunkturschädlich. Wem
soll man nun glauben? Falsche Prognosen haben uns bekanntlich
schon häufiger in die Irre geführt. [1]
Nach Ludwig Erhard, Mitbegründer des Konzepts der sozialen
Marktwirtschaft und von 1963 bis 1966 Bundeskanzler, beruhen
50 Prozent der Wirtschaft auf Psychologie. Ginge es allein
danach, wäre der Aufschwung sicherlich noch auf Jahre hinaus
gesichert. So war beispielsweise der ifo-Geschäftsklimaindex
im Dezember 2006 mit 108,7 Punkten höher als je zuvor seit der
Wiedervereinigung. Zur Erinnerung: Seinerzeit wuchs unser
Bruttoinlandsprodukt im Zuge des Wiedervereinigungsbooms um
beachtliche 5,1 Prozent. Positiver könnten die Aussichten also
kaum sein. Wenigstens auf den ersten Blick.
Doch
Vorsicht: "O schwöre nicht beim Mond, dem wandelbaren, der
immerfort in seiner Scheibe wechselt." (Shakespeare, Romeo und
Julia) Mit anderen Worten: Nichts ist so unbeständig wie
Stimmungen. Zudem geben sie lediglich Erwartungen wieder,
nicht unbedingt den tatsächlichen Verlauf. Überdies gibt es
konzeptionelle Zweifel: Folgt die Stimmung bloß der
Wachstumskurve oder sagt sie deren Verlauf wirklich
zuverlässig voraus? Egal, auch der Optimistischste wird auf
Dauer - Stimmung hin oder her - an harten ökonomischen Fakten
kaum vorbeikommen.
Fakten stehen für die anderen 50 Prozent der Wirtschaft.
Vordergründig sind sie wie in Stein gemeißelt, doch bedürfen
sie notwendigerweise der Interpretation. Und ich verrate Ihnen
kein Geheimnis, wenn ich darauf hinweise, dass man in dieser
Beziehung ebenfalls enorm zerstritten sein kann. Aus der Fülle
von statistischen Daten sucht sich jeder die für die eigene
Meinung passenden heraus, die weniger geeigneten werden in der
Regel ignoriert. Das ist menschlich. Aber genau deshalb ist es
so schwer, sich selbst auf der Grundlage von feststehenden
Fakten über die richtige Wirtschaftspolitik zu einigen. Die
neunköpfige Hydra ist nichts gegen das Jahrbuch des
Statistischen Bundesamts (Umfang 688 Seiten). Immer wenn man
glaubt, mit einer bestimmten Zahlenkolonne einen Kopf
abgeschlagen und die Sache damit klar gemacht zu haben, wächst
der nächste in Form einer anderen Zahlenkolonne nach und der
Kampf geht weiter. Das Ungeheuer ist folglich kaum zu
bändigen.
Ist der gegenwärtige Optimismus übertrieben? Ein Teil der
Fakten ist in der Tat erfreulich: Die Steuereinnahmen des
Staates steigen, die sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten ebenso. Doch ist dadurch schon ein nachhaltiger
Aufschwung gesichert? Daran darf gezweifelt werden. Und wo
kommt der Aufschwung überhaupt her? Wenn man genauer hinsieht,
kann man zwar durchaus eine kleine Trendwende unterstellen,
allerdings sind wir immer noch weit vom Ausgangspunkt zu
Beginn der Wiedervereinigung entfernt (von den Zeiten der
Vollbeschäftigung ganz zu schweigen). Und damals hatten wir
knapp drei Millionen Arbeitslose, die Situation war mithin
bereits 1992 alles andere als rosig. Im November 2006 lag die
Zahl der Arbeitslosen um 1 Mio. bzw. 34,1 Prozent über dem
Jahresdurchschnitt von 1992. Die aussagekräftigeren - weil auf
ihnen unser Sozialsystem beruht -
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten lagen im
September 2006 (neuere Daten liegen noch nicht vor) um 2,4
Mio. respektive 8,3 Prozent unter dem Stand von vor 14 Jahren.
Ob man somit von einer echten Trendwende sprechen kann, muss
sich erst noch zeigen.
| Arbeitslose in Mio. |
| 1992 |
2,979 |
| 1993 |
3,419 |
| 1994 |
3,698 |
| 1995 |
3,612 |
| 1996 |
3,965 |
| 1997 |
4,384 |
| 1998 |
4,279 |
| 1999 |
4,099 |
| 2000 |
3,889 |
| 2001 |
3,852 |
| 2002 |
4,060 |
| 2003 |
4,376 |
| 2004 |
4,381 |
| 2005 |
4,861 |
| Jan. 2006 |
5,010 |
| Juni 2006 |
4,399 |
| Nov. 2006 |
3,995 |
| Quelle: a) 1992-2005: Statistisches
Taschenbuch 2006, Arbeits- und Sozialstatistik,
Herausgeber: Bundesministerium für Arbeit und
Soziales, Tabelle: 2.10 b) Jan. - Sept. 2006:
Bundesagentur für Arbeit, Der Arbeits- und
Ausbildungsmarkt in Deutschland, November 2006,
Tabelle 8 |
| Sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte in Mio. |
| Juni 1992 |
29,325 |
| Juni 1993 |
28,596 |
| Juni 1994 |
28,238 |
| Juni 1995 |
28,118 |
| Juni 1996 |
27,739 |
| Juni 1997 |
27,280 |
| Juni 1998 |
27,208 |
| Juni 1999 |
27,483 |
| Juni 2000 |
27,826 |
| Juni 2001 |
27,817 |
| Juni 2002 |
27,571 |
| Juni 2003 |
26,955 |
| Juni 2004 |
26,524 |
| Juni 2005 |
26,178 |
| Juni 2006 |
26,343 |
| Sept 2006 |
26,883 |
| Quelle: a) 1992-2005: Statistisches
Bundesamt, Statistisches Jahrbuch, Seite 88 b)
Juni u. Sept. 2006: Bundesagentur für Arbeit, Der
Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Deutschland,
November 2006, Tabelle 13 |
Die viel
wichtigere Frage ist, wie lange hält das Ganze an? Denn an den
ungünstigen Rahmenbedingungen hat sich bedauerlicherweise
nicht allzu viel geändert. Nach wie vor liegen zum Beispiel
die realen Nettoverdienste der Arbeitnehmer deutlich (6,3
Prozent) unter dem Stand von 1992, die Konjunktur lebt daher
weiterhin primär vom Erfolg auf dem Weltmarkt. [2] Der
neoliberalen Theorie zufolge hätten die Unternehmen die beim
Export erzielten Gewinne reinvestieren und dadurch
Arbeitsplätze aufbauen müssen, was wiederum der
Binnenkonjunktur zugute gekommen wäre. Doch dies hat sich
schon in der Vergangenheit als Wunschdenken entpuppt und mit
der Realität nicht viel zu tun. Warum sollte es jetzt anders
sein? Ob sich 2007 die - für den Binnenmarkt - ungünstigen
Rahmenbedingungen gravierend ändern, etwa durch höhere
Tarifabschlüsse, steht in den Sternen.
| Nettorealverdienste je
Arbeitnehmer / Jahr in € |
| 1992 |
17251 |
| 1993 |
17280 |
| 1994 |
16843 |
| 1995 |
16673 |
| 1996 |
16400 |
| 1997 |
15886 |
| 1998 |
15916 |
| 1999 |
16104 |
| 2000 |
16217 |
| 2001 |
16421 |
| 2002 |
16360 |
| 2003 |
16299 |
| 2004 |
16428 |
| 2005 |
16158 |
| Quelle: Statistisches Taschenbuch 2006,
Arbeits- und Sozialstatistik, Herausgeber:
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Tabelle:
1.15 |
Kein
Wunder, wenn der Binnenmarkt darniederliegt. Das bekommt der
Einzelhandel schmerzhaft zu spüren. So haben sich die
preisbereinigten Umsätze des Einzelhandels seit Jahren
ungefähr auf der gleichen Höhe eingependelt. Unter den
zusätzlichen Belastungen, die auf die Konsumenten in diesem
Jahr zukommen, hat er deshalb besonders zu leiden.
Einzelhandelsumsätze*
real
(Index: 2003 = 100) |
| 1994 |
100,5 |
| 1995 |
101,2 |
| 1996 |
100,6 |
| 1997 |
98,9 |
| 1998 |
100,0 |
| 1999 |
100,5 |
| 2000 |
101,7 |
| 2001 |
101,9 |
| 2002 |
100,5 |
| 2003 |
100 |
| 2004 |
102,1 |
| 2005 |
103,8 |
| 1.Vj.2006 |
97,6 |
| 2.Vj.2006 |
102,8 |
| 3.Vj.2006 |
101,4 |
|
*ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und ohne
Tankstellen; Reparatur von Gebrauchsgütern
Quelle: Sachverständigenrat zur
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung, Jahresgutachten 2006/07,
Statistischer Anhang, Tabelle 64 (Daten vor 1994
nicht verfügbar)
|
Das Jahr
2007 ist gewissermaßen ein volkswirtschaftliches Experiment.
Noch nie zuvor war die Anhebung der Mehrwertsteuer so enorm,
künftig sind statt 16 mit einem Schlag 19 Prozent zu
entrichten. Die Arbeitnehmer werden das zu spüren bekommen.
Gleichzeitig steigen die Beiträge zur Rentenversicherung von
19,5 auf 19,9 Prozent und die Krankenkassenbeiträge je nach
Kasse um bis zu 1,6 Prozent. Außerdem werden der
Sparerfreibetrag und die Pendlerpauschale gehörig
zusammengestrichen. Zum Ausgleich sinkt jedoch die Belastung
bei der Arbeitslosenversicherung, hier reduziert sich der
Beitragssatz von 6,5 auf 4,2 Prozent. Durch Letzteres werden
die Arbeitnehmer um ca. 7,5 Mrd. entlastet, freilich wird
allein die Belastung durch die Mehrwertsteuererhöhung auf rund
19,4 Mrd. Euro taxiert. Per Saldo müssen die Arbeitnehmer in
diesem Jahr nach Angaben des Bundesverbands der
Verbraucherzentralen mit einer Mehrbelastung von 23,6 Mrd.
Euro rechnen - und das bei sinkenden oder bestenfalls
stagnierenden Realeinkommen. Arbeitslose, Rentner und
Studenten erhalten gar keine Entlastung, sie werden
überproportional zur Kasse gebeten. Unberücksichtigt geblieben
sind in diesem Zusammenhang die weiter ansteigenden
Energiepreise. Alles in allem ist der Kurs Gift für die
Kaufkraft und demzufolge Gift für die lahmende
Binnenkonjunktur.
Schon einmal ist ein derart gewagtes Steuerreform-Experiment
gehörig danebengegangen. Im Jahr 2000 rühmte sich die
rot-grüne Bundesregierung, sie habe "die größte Steuerreform
der Nachkriegsgeschichte" auf den Weg gebracht. Mag sein, dass
sie das tatsächlich gewesen ist, jedenfalls haben sich die
Regierenden dabei kolossal verkalkuliert. Als die Steuerreform
im Jahr 2001 wirksam wurde, ging das Wirtschaftswachstum
prompt in die Knie. Ein fiskalpolitischer Fehler ohnegleichen,
mit dessen Auswirkungen wir heute noch zu kämpfen haben.
Was
schließen wir daraus? Das Experiment Mehrwertsteuererhöhung
kann den fragilen Aufschwung abrupt abwürgen. Die Meinungen,
ob es wirklich dazu kommt, gehen indes stark auseinander. Wenn
sich an der Lage auf dem Binnenmarkt nichts grundlegend
ändert, dürfte die aktuelle Belebung ein kurzes Strohfeuer
gewesen sein. Wie so oft in der Vergangenheit. Eine Besserung
auf dem Arbeitsmarkt hat nebenbei bemerkt nicht unbedingt
etwas mit guter Wirtschaftspolitik zu tun. In den kommenden
Jahren drängen wesentlich weniger Schüler auf den Arbeitsmarkt
- erste Auswirkungen der Demographie.
Dies auf
die Politik der Bundesregierung zurückzuführen, könnte sich
als trügerisch erweisen. Eventuell rühmt sich die Regierung
bald mit falschen Lorbeeren, gewiefte PR-Experten verkaufen
den Rückgang der Arbeitslosigkeit dann als Folge der
Regierungspolitik, obgleich er bloß auf die Änderung beim
demographischen Aufbau der Bevölkerung zurückzuführen ist.
Positive Auswirkungen, die man auf eine falsche Ursache
zurückführt, sind jedoch wenig hilfreich, weil sie den wahren
Kern verdecken.
----------
[1] siehe hierzu Was
sind Gutachten eigentlich wert? vom 08.08.2004
[2] siehe hierzu Deutschland
abermals Exportweltmeister vom
02.01.2007
|
|