
| Home | Archiv
| Impressum 05. Februar 2007, von Michael Schöfer Ist der Klimawandel unumkehrbar? Künftige Generationen werden vermutlich mit Unverständnis auf uns zurückblicken. War den damaligen Menschen, werden sie fragen, nicht spätestens seit Anfang der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts bekannt, wohin der Treibhauseffekt führt? Natürlich, der schwedische Nobelpreisträger Svante Arrhenius hat schon 1895 die Klimaeffekte von Treibhausgasen erkannt. Und warum haben sie dann ihr klimaschädliches Verhalten nicht geändert? Ratlosigkeit, Enttäuschung und Wut wird sich breit machen, doch es wird ihnen nichts nützen. Denn diejenigen, die mit den ersten Berichten des IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen) konfrontiert waren und dadurch eigentlich hätten gewarnt sein müssen, sind zu jenem Zeitpunkt bereits längst tot. Es sind unsere Urenkel, die diese unangenehmen Fragen stellen werden. Hören werden wir sie nicht, doch ihre Fragen sind nur allzu berechtigt. Warum rennt die Menschheit sehenden Auges in die Klimakatastrophe hinein, ohne sich ihr mit allen Kräften entgegenzustemmen? Jared Diamond hat in seinem interessanten Buch "Kollaps - warum Gesellschaften überleben oder untergehen" erläutert, warum Gesellschaften zuweilen ihre eigene Lebensgrundlage zerstören und daran letztlich zerbrechen. Besonders beeindruckend ist ihm das am Beispiel der Osterinsel gelungen. Die Osterinsel im pazifischen Ozean ist einer der abgelegensten Orte der Erde: 3.700 km von der chilenischen Küste und mehr als 2.000 km von der nächsten bewohnten Insel entfernt. Man schätzt, dass die Polynesier das Eiland um 900 n. Chr. besiedelten. Bis 1770, als erstmals Europäer auf der Insel landeten, lebten sie dort völlig von der Außenwelt isoliert. Einst sollen auf der Insel 15.000 Menschen gewohnt haben, die Europäer fanden im 18. Jahrhundert allerdings bloß noch zwei- bis dreitausend Insulaner vor. Mittlerweile war es dort zu einer ökologischen Katastrophe gekommen, der u.a. der gesamte Waldbestand der Insel zum Opfer fiel. Wegen des ökologischen Zusammenbruchs kam es auf der Osterinsel zu einem gesellschaftlichen Kollaps, den das Gros der Bevölkerung nicht überlebte. Berühmt geworden ist die Osterinsel durch riesige Steinstatuen, die "Moais". Eine durchschnittliche Statue wog 10 Tonnen und war knapp vier Meter hoch. Die größte, die je von den Einwohnern der Osterinsel aufgestellt wurde, war 6,60 Meter hoch und wog 75 Tonnen. In einem Steinbruch fand man eine 21 Meter hohe, freilich noch unvollendete Statue mit einem Gewicht von 270 Tonnen. Mindestens 887 Statuen wurden von den Insulanern aus dem Fels gehauen, die Hälfte davon kilometerweit abtransportiert und ohne Hilfe von Kränen aufgerichtet. Was bewog die Einwohner einerseits so viel Energie in die Aufstellung von auf den ersten Blick vollkommen nutzlosen Steinstatuen zu investieren, andererseits jedoch der nahenden Öko-Katastrophe ihrer überschaubaren Heimat keine der Situation angemessene Aufmerksamkeit zu schenken? Imponiergehabe, sagt Diamond. Die Skulpturen dienten nämlich dem Ansehen der Häuptlinge, und jeder wollte dabei den anderen übertreffen. Das vollständige Abholzen der Wälder hatte u.a. zur Folge, dass die Osterinsel-Bewohner auf seetüchtige Kanus verzichten mussten und demzufolge nicht mehr auf hoher See jagen konnten, was ihre Ernährungsbasis stark einschränkte. War das den Insulanern egal? Wie auch immer, jedenfalls steckten sie in die Erhaltung ihrer Lebensgrundlage weniger Energie, als in den Bau der Moais. Der gesellschaftliche Status ihrer Häuptlinge hatte unverständlicherweise eine höhere Priorität. Die Konsequenzen sind bekannt. Reagieren wir grundlegend anders? Der neueste IPCC-Bericht hat die Öffentlichkeit schockiert - wenigstens vorübergehend. Im günstigsten Fall soll die globale Durchschnittstemperatur bis zum Ende des Jahrhunderts um 1,1 Grad ansteigen, im ungünstigsten Fall sind es 6,4 Grad. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Temperatur-Unterschied zwischen der letzten Eiszeit vor 15.000 Jahren und heute beträgt etwa fünf Grad. Der Meeresspiegel könnte im gleichen Zeitraum 18 bis 38 cm (niedriges Szenario) oder 26 bis 59 cm (hohes Szenario) ansteigen. Bei einem Anstieg um einen Meter sind beispielsweise in den Niederlanden 48,4 Prozent der Staatsfläche und 5,1 Mio. Menschen betroffen. [1] Auf der Website von Flood Maps kann jeder selbst simulieren, welche Folgen der Meeresspiegelanstieg auf bestimmte Regionen der Erde hat. Schmilzt der Eisschild Grönlands, steigt der Meeresspiegel am Ende sogar um beachtliche 7,2 Meter - mit dramatischen Auswirkungen auf die dichtbesiedelten Küstenregionen der Erde. Schätzungen zufolge lebt dort rund die Hälfte der Weltbevölkerung. Städte müssten aufgegeben und Menschen umgesiedelt werden - mit allen daraus resultierenden negativen Konsequenzen für die Ökonomie und den Weltfrieden. Die heute existierenden Verteilungskämpfe sind wohl ein laues Lüftchen gegen die uns bevorstehenden. 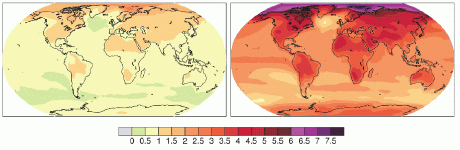  [Quelle:
WBGU, Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung
Genauso
wie wir heute angesichts des Verhaltens der
Osterinsel-Bewohner die Hände über dem Kopf zusammenschlagen,
werden dereinst unsere Nachfahren über uns urteilen. Bestimmt
quittieren sie unser Verhalten mit völligem Unverständnis,
schließlich sind wir noch nicht einmal in der Lage, auf
deutschen Autobahnen ein Tempolimit einzuführen. Eine
Maßnahme, die im Gegensatz zu allen anderen sofort wirksam
wäre und keine zusätzlichen Kosten verursacht. Stattdessen
halten wir - analog zum Gebrauch der Steinskulpturen auf der
Osterinsel - an unserem unsinnigen, dem Ernst der Situation
absolut unangemessenen Imponiergehabe fest. Was dem Polynesier
auf der Osterinsel sein Moai, ist dem Deutschen sein Auto.
Offenbar opfern wir lieber die deutsche Nordseeküste, als den
Gebrauch unseres liebsten Spielzeugs einzuschränken. Protzen
mit dem Gaspedal ist anscheinend wichtiger. Das verstehe wer
will.
Sondergutachten 2006, PDF-Datei mit 3,3 MB]
Ein Mercedes stößt pro Kilometer im Durchschnitt 186 Gramm CO2 aus, ein BMW sogar 192 Gramm, ein Smart dagegen nur 116 Gramm. [2] Die deutsche Autoindustrie hat sich freiwillig verpflichtet, bis 2008 140 Gramm zu erreichen, was einem Verbrauch von 5,6 Liter/100 km entspricht. Gegenwärtig liegt der Durchschnitt jedoch bei 162 Gramm (= 6,5 Liter/100 km). Geht es nach der EU-Kommission, werden die CO2-Emissionen bis 2012 sogar auf 120 Gramm (= 4,8 Liter/100 km) sinken. [3] Da deutsche Autos aber immer schwerer und schneller werden, kann die Automobilindustrie nicht einmal ihre freiwillige Selbstverpflichtung einhalten, von schärferen Grenzwerten ganz zu schweigen. Wie bei der Einführung des Katalysators oder des Rußpartikelfilters malen deshalb die Lobbyisten den Tod der deutschen Autoindustrie an die Wand. Und die Politiker knicken daraufhin reihenweise ein. Bundeskanzlerin Angela Merkel "sprach sich dafür aus, in der EU nach Autogröße gestaffelte Abgasgrenzwerte einzuführen. Sie sei für weitere Senkungen des CO2-Ausstoßes auch bei Autos, sagte sie. Aber man kann nicht alle Autos über einen Kamm scheren. Kleinwagen müssen andere Grenzwerte als ein großes Familienauto haben. Deshalb sind pauschale Abgasgrenzwerte falsch." Selbstverständlich sieht sie auch keine Notwendigkeit für ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen. "Die Diskussion über ein generelles Tempolimit sehe ich nicht", sagte Merkel lapidar. [4] Langsam fahren und dabei Sprit sparen kommt - trotz Treibhauseffekt - nicht in Frage. Angesichts dessen kann man durchaus nachvollziehen, wenn künftige Generationen über uns bloß noch den Kopf schütteln. Alle sprechen sich für den Klimaschutz aus, doch wenn es konkret wird, will man nichts mehr davon wissen. So vergeuden wir wertvolle Zeit und gehen das Risiko ein, dass uns die Entwicklung endgültig aus den Händen gleitet. Kommt etwa tatsächlich die Eisschmelze in Grönland in Gang, wofür es gegenwärtig deutliche Anzeichen gibt, ist der drastische Anstieg des Meeresspiegels fast nicht mehr zu verhindern. Das Klimasystem ist normalerweise relativ träge, doch gerät es einmal aus dem Lot, ist es gerade aufgrund dieser Trägheit nur schwer wieder zu stabilisieren, insbesondere wenn es zu positiven Rückkopplungseffekten kommt. Ein Beispiel: Die Erwärmung setzt vermehrt Methan frei, was zu einer stärkeren Erwärmung führt, die wiederum noch mehr Methan freisetzt. Zwar pendelt sich das Klima irgendwann auf einem anderen Niveau ein, doch haben sich die Verhältnisse bis dahin fundamental gewandelt. Eine Rückkehr zum gewohnten Niveau dürfte uns dann womöglich für Jahrtausende verbaut sein. Ist der Klimawandel unumkehrbar? Nach den bislang vorliegenden Daten ist er das, wir können allein das Ausmaß der Temperaturerhöhung beeinflussen. Doch dazu müsste man endlich einschneidende Maßnahmen zur Begrenzung der CO2-Emissionen ergreifen. Was wir bräuchten, wäre ein Marshallplan zur Einleitung der Energiewende. Nicht kleckern, sondern klotzen müssten wir, weil uns nach den jetzigen Erkenntnissen lediglich ein Zeitfenster von zwei Jahrzehnten bleibt. Maßnahmen, die später kommen, sind womöglich nutzlos. Teurer sind sie allemal. Es liegt an uns, unter welchen Umständen künftige Generationen leben werden. Bewundern sie uns für unsere Energieleistung, weil wir gerade noch rechtzeitig die Kurve gekriegt haben? Oder werden wir ihnen Rätsel aufgeben, weil wir sehenden Auges in die Klimakatastrophe gerannt sind? Mit anderen Worten: Teilen wir das traurige Schicksal der Osterinsel-Bewohner? Oder sind wir zu größeren Anpassungsleistungen fähig, die unsere Gesellschaft im Kern bewahren? Das ist die alles entscheidende Frage. ---------- [1] Hamburger Bildungsserver [2] Frankfurter Rundschau vom 23.01.2007 [3] Frankfurter Rundschau vom 24.01.2007 [4] FAZ vom 04.02.2007 Nachtrag (06.02.2007): Bundeskanzlerin Merkel: "Wir werden verhindern, dass es eine generelle Reduktion gibt." Und sie fügte hinzu: "Mit aller Härte, Kraft und Energie." [5] Das ist gelungen, ihr Einsatz fürs "heilig's Blechle" hat sich gelohnt, die EU-Kommission ist nämlich soeben eingeknickt. Der Kompromiss: Die Autohersteller müssen bis 2012 durch die Verbesserung der Motorentechnik nur einen Wert von 130 Gramm erreichen, weitere 10 Gramm "sollen durch den Einsatz von Biosprit und durch andere Neuerungen gewährleistet werden, etwa durch effizientere Klimaanlagen oder optimalen Reifendruck." [6] Zudem: "Feste CO2-Grenzwerte für einzelne Hersteller muss die Autoindustrie nicht befürchten." Wie die Klimaschutzvorgaben auf die europäische Autoindustrie verteilt werden, bleibt vorerst offen. Spätestens jetzt trägt Merkel das Etikett "Autokanzlerin", das schon ihren Vorgänger "ausgezeichnet" hat. In Bezug auf das Weltklima war die Nachricht allerdings weniger gut. Wir sind eben nicht nur Exportweltmeister, sondern auch Weltmeister in Umweltrhetorik. Bloß mit dem konkreten Handeln hapert es halt noch ein bisschen. [5] diepresse.com vom 03.02.2007 [6] Süddeutsche vom 06.02.2007 |
