
| Home | Archiv
| Impressum 01. Juni 2008, von Michael Schöfer Es gibt immer einen Hinderungsgrund Der Energieversorger EnBW (Energie Baden-Württemberg AG) möchte in Karlsruhe ein neues Steinkohlekraftwerk bauen, das alte Kraftwerksblöcke ersetzen soll. "Bei der EnBW werden voraussichtlich bis zum Jahr 2012 konventionelle Kraftwerksblöcke (Kohle, Gas, Öl) mit einer Gesamtleistung von rund 930 MW ihr Lebensdauerende erreicht haben. Diese haben im Durchschnitt eine spezifische CO2-Emission von rund 850 g/kWh. Dank dem Einsatz modernster Technik erreicht der [neue] Steinkohleblock RDK 8 mit einer Leistung von 912 MW einen Nettowirkungsgrad von mehr als 46 %. Damit liegen die spezifischen CO2-Emissionen bei ca. 740 g/kWh", schreibt das Unternehmen. [1] Die spezifischen CO2-Emissionen werden also nach Angaben von EnBW um 12,9 Prozent zurückgefahren. Das ist, isoliert betrachtet, zunächst positiv zu bewerten. Allerdings werden die CO2-Emissionen durch den rund 40-jährigen Kraftwerksbetrieb für diese Zeit auch festgeschrieben. Insofern ist das neue Steinkohlekraftwerk wiederum schlecht für die Klimaziele der Bundesregierung, die den CO2-Ausstoß in Deutschland bis 2020 um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 verringern will (ökologisch notwendig wären eigentlich 80 Prozent). Mit dem Bau neuer Kohlekraftwerke kann die Bundesregierung ihre Klimaziele vergessen, sie sind auf diesem Weg kaum zu erreichen. Warum setzt EnBW nicht auf dezentrale Blockheizkraftwerke, die einen Wirkungsgrad von 80 bis 90 Prozent erreichen und doppelt so effizient arbeiten? Damit könnten sich die CO2-Emissionen noch deutlicher nach unten fahren lassen. Überdies sind Blockheizkraftwerke prinzipiell auch mit Biomasse zu betreiben, sie wären dann klimaneutral. "Ein Blockheizkraftwerk besteht aus einem stationären Motor, der nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung sowohl elektrischen Strom als auch Wärme produziert. Die Effektivität von BHKWs beruht auf der Nutzung der Abwärme, die in anderen Kraftwerken über das Kühlwasser ungenutzt in Flüsse geleitet wird. Der hohe Wirkungsgrad der Blockheizkraftwerke macht beträchtliche Energieeinsparungen möglich. Betrieben werden BHKWs entweder mit Gas, Öl oder Holz (Holzvergasung), aber auch mit Raps-Methyl-Ester (RME)." [2] Natürlich entsprechen dezentrale Blockheizkraftwerke nicht der monopolartigen Struktur der großen Energieversorgungsunternehmen, deshalb werden sie von diesen nicht favorisiert. Das Interesse der Energieversorger ist nämlich keineswegs die möglichst effiziente Bereitstellung von Energie, sondern vielmehr das Erzielen möglichst hoher Gewinne. EnBW hat beispielsweise das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen 2003 und 2007 von 1.014 Mio. Euro auf 2.336 Mio. Euro gesteigert (ein Plus von 130 Prozent). Die Mitarbeiter haben sich übrigens im gleichen Zeitraum von 33.224 auf 20.499 verringert. [3] Durch dezentrale Blockheizkraftwerke wären die Interessen der Energieversorger in hohem Maße gefährdet, weil sie deren Monopol tangieren. Blockheizkraftwerte können von wesentlich kleineren Unternehmen gebaut und betrieben werden. Firmen, die außerdem eventuell zusätzliche Arbeitsplätze schaffen anstatt welche abzubauen. Es gibt halt immer einen Grund, das ökonomisch wie ökologisch Sinnvolle zu unterlassen. Wie bei der Autoindustrie, die den Bau von umweltverträglicheren Autos total verschlafen hat. Bislang lautete bekanntlich ihr Motto: stärker, schneller, schwerer, teurer. So ist der Durchschnittsverbrauchs der Pkw in Deutschland nach Angaben des Umweltbundesamtes zwischen 1991 und 2005 von 9,2 Liter/100 km auf 7,7 Liter zurückgegangen, das ist eine Reduktion von lediglich 1,5 Litern bzw. 16,3 Prozent. [4] Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch der Neuzulassungen des Jahres 2007 lag nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes bei 7,1 Liter (Benziner) bzw. 6,5 Liter (Diesel). Wohlgemerkt: der Neuzulassungen! [5] Auch hier verhinderten Partikularinteressen eine vernünftigere Entwicklung. 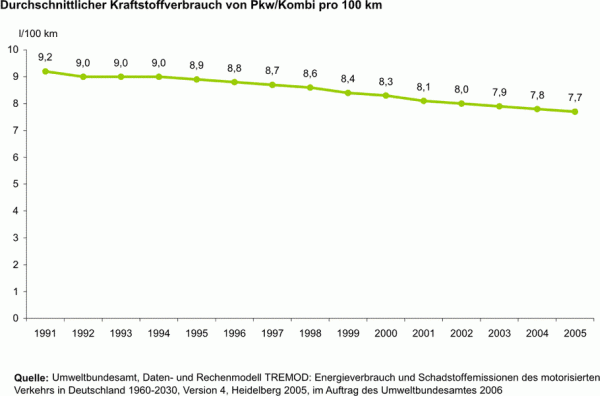 Normalerweise haben Politiker die Aufgabe, Partikularinteressen dem Gemeinwohl zuliebe hintanzustellen. Doch die politische Realität sieht anders aus: "Im April hat der Bundesrechnungshof aufgedeckt, dass in den letzten Jahren etwa 300 Lobbyisten aus Unternehmen und Verbänden eigene Schreibtische in den Ministerien hatten. Viele wurden von der Privatwirtschaft weiter bezahlt und haben an Gesetzesvorlagen mitgewirkt, die ihre eigenen Unternehmen betreffen. Soziale- oder Umweltbelange hingegen bleiben vor der Tür." [7] Die Wirtschaft hat offenbar den Staat okkupiert. Kein Wunder, wenn Gesetze häufig wachsweich ausfallen und die Politik sich ständig von "freiwilligen" Lösungen einlullen lässt, die von der Wirtschaft allerdings selten eingehalten werden. Es wird Zeit, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Nicht bloß gegen neue Kohlekraftwerke und allzu durstige Spritfresser, sondern ebenso gegen den unheilvollen Einfluss der Lobbyisten. Wir Bürger sind der Staat, nicht die Unternehmen. LobbyControl hat daher die Aktion "Keine Lobbyisten in Ministerien!" gestartet. Hier kann man seinem Bundestagsabgeordneten eine Protestmail schicken. Je mehr Gegenwind es gibt, desto früher hört dieser Wahnsinn vielleicht auf. ---------- [1] EnBW [2] Der Solarserver [3] EnBW, Geschäftsbericht 2007, Seite U5, PDF-Datei mit 4,4 MB [4] Umweltbundesamt [5] KBA [6] siwssinfo.ch vom 20.05.2008 [7] LobbyControl, Initiative für Transparenz und Demokratie, vom 27.05.2008 |
