
| Home | Archiv
| Impressum 14. Juni 2008, von Michael Schöfer Die Welt ist flach (eine Rezension) Warum müssen Bücher über Globalisierung dick sein? Weil es ein komplexes Themengebiet ist? Vielleicht. Jedenfalls präsentiert uns Thomas L. Friedman, Journalist bei der New York Times und dreifacher Träger des Pulitzer-Preises, mit seinem Buch "Die Welt ist flach" einen Wälzer von immerhin 762 Seiten. Naomi Kleins "No Logo" steht dem mit 521 Seiten in nichts nach. Quantitativ und qualitativ. Genau zwischen diesen beiden Polen bewegt sich gegenwärtig auch die Globalisierungsdiskussion: Hier der optimistische Friedman, der die Globalisierung vor allem durch die sich bietenden Chancen begreift, dort die skeptische Klein, die die Globalisierung primär aus der Perspektive der Arbeitssklaven in den Sweatshops beurteilt. Beide Sichtweisen, hier die überwiegend betriebswirtschaftlich geprägte, dort die eher moralisch argumentierende (das ist keineswegs abwertend gemeint), haben ihre Berechtigung, denn der Globalisierungsprozess ist in der Tat äußerst komplex. Friedman macht uns auf den Tsunami aus gut ausgebildeten und extrem preiswerten Fachkräften in China respektive Indien aufmerksam, der augenblicklich über unsere Arbeitswelt hinwegfegt. Sein Lieblingsbeispiel ist die Software-Industrie in Bangalore, das indische Silicon Valley. Friedman zufolge ist die Globalisierung in eine neue Phase eingetreten. "Nicht mehr allein die Herstellung von Turnschuhen und T-Shirts, auch geistige Dienstleistungen werden heute dort erbracht, wo sie am wenigsten kosten. Friedmans Erkenntnis: Die Welt des 21. Jahrhunderts ist flach, der Globus eingeebnet durch die Möglichkeit, digitale Daten von beliebigen Winkeln der Erdkugel in andere zu verschicken, und zwar höchst billig und weitaus schneller, als man einen Stapel Papiere von Büro zu Büro tragen kann." Friedman beschreibt Wertschöpfungsketten, die den gesamten Globus umspannen. Dieser Tsunami wird seiner Ansicht nach alles verändern. Wer sich nicht bewegt, wird unweigerlich zerschmettert. Nicht real, aber indem er Arbeit verliert und somit Wohlstandsverluste erleidet. Die Beispiele, die Friedman bringt, sind fürwahr beeindruckend. Was bei ihm leider zu kurz kommt, ist die Globalisierungskritik. Die Globalisierung ist nämlich nicht mit einem schier unaufhaltsamen Naturereignis vergleichbar, sie wurde vielmehr von den Menschen selbst verursacht. In internationalen Abkommen hat man zwar einerseits die Zollschranken peu à peu beseitigt, andererseits legte man auf soziale Mindeststandards bedauerlicherweise keinen Wert. Doch erst dadurch kam der Tsunami zustande: Ein aus politischen Verträgen und technischen Innovationen resultierendes Beben, bei dem von den neoliberalen Ideologen bewusst "vergessen" wurde, die Gebäude im eigenen Hinterland erdbebenfest zu machen. Es geht daher nicht darum, ob man Globalisierung zulässt oder nicht, sondern wie man sie konkret gestaltet. Natürlich ist das Argument, der Westen habe die Menschenrechte in der sogenannten Dritten Welt erst entdeckt, als er sich durch deren Billigarbeitskräfte bedroht sah, bis zu einem gewissen Grad zutreffend. Sofern wir jedoch soziale Mindeststandards nicht als Schutz vor der Konkurrenz, sondern vorrangig als generellen Schutz vor der Ausbeutung begreifen, egal wo sie stattfindet und wer sie praktiziert, haben soziale Mindeststandards ihre Berechtigung. Mit anderen Worten: Es geht nicht darum, selbst wohlhabend zu bleiben, während die Armut der anderen zementiert wird, sondern darum, möglichst allen Menschen ein Leben in Wohlstand zu verschaffen. Ein Zurück in vermeintlich goldene Zeiten ist weder realistisch noch (aus globaler Sicht) wünschenswert. Es kommt aber darauf an, die Richtung zu bestimmen, in die sich das Ganze entwickelt. Friedman ist ein erklärter Anhänger des Freihandels. Diese Sicht muss man nicht teilen. Staatliche Regulierung ist unerlässlich, das zeigen uns gegenwärtig die Turbulenzen auf dem internationalen Finanzmarkt oder die verhängnisvolle Nahrungsmittelkrise. Regulierung bedeutet schließlich nicht bloß Schutz vor den Auswüchsen des Marktes, der auf dem sozialen Auge bekanntermaßen blind ist, sie ist auch ein Mittel, das Primat der Politik zurückzugewinnen. Nationen sind keine Aktiengesellschaften, selbst wenn ein weitverbreitetes Vorurteil etwas anderes suggeriert, deshalb darf man sie auch nicht wie ein Unternehmen regieren. Demokratie bedeutet, mehr als bloß ökonomische Aspekte zu berücksichtigen. Letztere sind zweifellos wichtig, aber eben nicht alles. In einem Unternehmen werden überflüssige Menschen entlassen (oder wie man so schön sagt: freigesetzt). In einer humanen Gesellschaft darf es keine überflüssigen Menschen geben. Friedmans Verdienst ist, kein einfältiger Freihandelsanhänger zu sein. Er spart beispielsweise nicht mit Kritik am amerikanischen Bildungssystem. Gleichwohl ist noch lange nicht ausgemacht, ob die Globalisierung tatsächlich, wie er es sieht, eine Win-win-Situation ist bzw. wenigstens potentiell eine solche sein könnte. Globalisierung mündet am Ende womöglich in einen Zustand, den Horst Afheldt 1994 in seinem Buch "Wohlstand für niemand?" beschrieben hat. Menschliche Arbeit wird billig wie Dreck, weil es in einer globalisierten Welt immer irgendwo einen gibt, der bereit ist, die gleiche Arbeit für weniger Lohn zu machen. Es gibt Belege für beides: Zweifellos entwickeln sich Länder wie China rasant und bauen dabei schnell eine vergleichsweise wohlhabende Mittelschicht auf. Im Gegensatz dazu bröckelt in den meisten Industriestaaten die Mittelschicht, das traditionelle Rückgrat der modernen Demokratie, nach und nach ab. Wohin dieser dynamische Prozess führt, bleibt einstweilen offen. Global gesehen waren bislang 20 Prozent der Weltbevölkerung reich und 80 Prozent arm. Nur konzentrierte sich der Reichtum in der Vergangenheit hauptsächlich auf die westlichen Industriestaaten. Wenn man die globalisierte Wirtschaft als ein System von kommunizierenden Röhren begreift, könnte es durchaus sein, dass sich an der Verteilung (20 Prozent Reiche zu 80 Prozent Arme) überhaupt nichts ändert. Was sich allerdings ändert, ist die globale Verteilung. Letzten Endes verteilen sich dann Reich und Arm nur gleichmäßiger über den Globus hinweg, so wie sich der Wasserstand in miteinander verbundenen Röhren automatisch angleicht. Kurz gesagt, die Armut ist in diesem Modell nicht mehr wie heute überwiegend auf bestimmte Regionen begrenzt. In welcher Röhre die Fettaugen schwimmen, ist - isoliert betrachtet - vollkommen unerheblich. 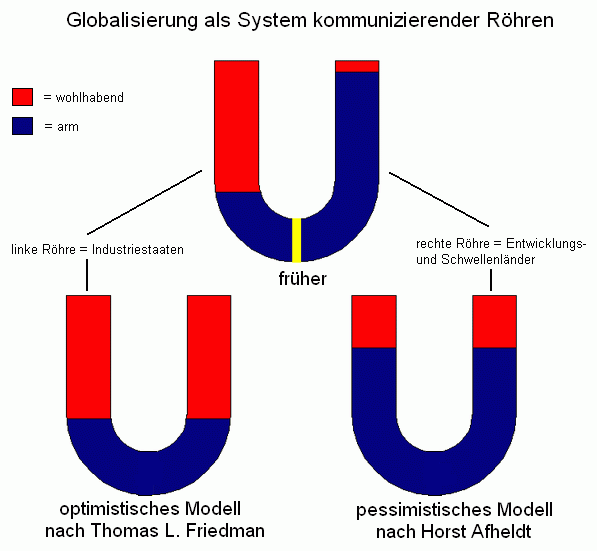 Alles in allem kann ich Friedmans Buch dennoch empfehlen, weil es den Blick auf die Globalisierung erweitert. Die Kritik an der globalisierten Wirtschaft wird dadurch nicht entwertet, sondern ergänzt, weil das Buch dem Laien tiefe Einblicke in das Wirtschaftsgeschehen bietet. Den Globalisierungsprozess strikter zu regulieren, als es der Kolumnist der New York Times empfiehlt, ist in meinen Augen jedoch unerlässlich. |
