
| Home
| Archiv
| Impressum 16. März 2009, von Michael Schöfer Gesellschaftliche Turbulenzen Gesellschaften wandeln sich häufig abrupt und ändern dadurch ihren Charakter grundlegend. Innere Ursachen (wirtschaftliche und ökologische Krisen) sind gegenüber äußeren (Kriege) keineswegs in der Minderzahl, nicht selten gingen der Eroberung längere Phasen des internen Zerfalls voraus. Ohne solche Zerfallserscheinungen hätten sie vielleicht dem äußeren Druck standgehalten. Beispiel Rom: Die römische Republik überdauerte fast genau 500 Jahre (von 510 v. Chr. bis 27 v. Chr.), doch geriet sie ungefähr Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. in eine schwere innenpolitische Krise. "Die Römer pflegten einen Teil des im Krieg eroberten Landes in Staatsbesitz zu überführen und bedürftigen Bürgern zur Nutzung zu überlassen. Um Aneignung großer Agrargüter in den Händen einiger weniger zu vermeiden, war der Landbesitz offiziell auf 500 Iugera beschränkt worden. Dieses Gesetz konnte jedoch nicht durchgesetzt werden. Wohlhabende Bürger legten sich riesige Landgüter zu. Dies wurde spätestens zu dem Zeitpunkt zum Problem, als praktisch alles Land innerhalb Italiens verteilt war und gleichzeitig immer mehr Sklaven infolge der siegreichen Kriege ins Land strömten. Die Kleinbauern und Handwerker aus der Schicht der Plebejer konnten mit dem durch die zahlreichen Kriege stetig anwachsenden Sklavenheer nicht konkurrieren. Gleichzeitig waren sie durch die zahlreichen Kriege außerhalb Italiens zu langer Abwesenheit gezwungen, was den Erhalt des heimischen Hofes weiter erschwerte. Die Großgrundbesitzer hingegen vergrößerten ihren Landbesitz durch den Kauf unprofitabler Höfe oder auch durch gewaltsame Vertreibungen. Die Verarmung breiter Bevölkerungsschichten führte zu Landflucht und erheblicher Unzufriedenheit. Andere Gruppen von Plebejern, die im Handel zu Reichtum gekommen waren, verlangten nach mehr Rechten. Die nach den Brüdern Tiberius Sempronius Gracchus und Gaius Sempronius Gracchus benannte Gracchische Reform sollte die Grundbesitzverhältnisse reformieren und den ärmeren Schichten der Bevölkerung zu Land und Einkommen verhelfen. Die Reform scheiterte allerdings am Widerstand der konservativen Senatskreise." [1] Die Republik ging im Bürgerkrieg unter, nach ihr kam die Kaiserzeit. Doch auch das Ende der römischen Kaiserzeit kündigte sich frühzeitig an - und damit zugleich der Untergang des weströmischen Reiches. "Über diese Krise ist viel theoretisiert worden, ohne dass sich die Historiker jedoch völlig auf die Ursachen einigen konnten. Fest steht, dass im 3. Jahrhundert das Edelmetall knapp wurde und damit Steuer- und Finanzwesen fast vollständig zum Erliegen kamen. Es kam zu einer immer rascheren Inflation [ca. 270 n. Chr.] und schließlich zu einem vollständigen Zusammenbruch der Währung. (...) Das zentrale Problem war nach wie vor die ausstehende Landreform. Die Latifundien hatten sich seit den Tagen Sullas [138 - 78 v. Chr.] unaufhaltsam weiter vergrößert. So schrieb Plinius schon im 1. Jahrhundert, dass sich die Hälfte der Provinz Afrika in den Händen von 6 Großgrundbesitzern befinde! Da der Staat kaum noch über brauchbares Land verfügte, hatte man schon seit langem damit begonnen, die ausscheidenden Legionäre mit Geld abzufinden. Aber die reichen Senatoren blockierten nicht nur die Landvergabe, sie bezahlten für ihre Latifundien natürlich auch keine Steuern." [2] Den Rest erledigten die "Barbaren": 410 n. Chr. wurde Rom von den Westgoten geplündert, 455 n. Chr. von den Vandalen. Der letzte Kaiser Westroms verlor 476. n. Chr. die Regentschaft. Sprung in die Neuzeit: Der "Pseudo-Sozialismus" ging ebenfalls an inneren Widersprüchen zugrunde (eklatanter Mangel an Demokratie, ökonomische Ineffizienz). Seine Existenz währte von 1917 bis 1991, von der Oktoberrevolution bis zur offiziellen Auflösung der Sowjetunion. Im Gegensatz zum Römischen Reich implodierte er nahezu lautlos, größere Kriege gab es jedenfalls keine. Nicht einmal zwanzig Jahre danach steckt auch der Kapitalismus, der sich nach dem Fall des eisernen Vorhangs bereits auf der Siegesstraße wähnte, in einer veritablen Krise, von der noch niemand weiß, wie sie am Ende ausgeht. Erneut sind innere Widersprüche (Finanzkrise, wachsende Kluft zwischen Arm und Reich) der Auslöser. Über Letztere ist schon viel geschrieben worden, deshalb möchte ich an dieser Stelle auf die weitere Erörterung verzichten. Was mich vielmehr beschäftigt, ist die Zukunft. Dass wir dem Casino-Kapitalismus ade sagen müssen, vertreten heutzutage selbst Konservative. Zumindest verbal (die FDP ist in dieser Beziehung weniger lernfähig). Aber was soll an seine Stelle treten? Kapitalismus light? Ob es mit ein bisschen mehr Regulierung und Transparenz wirklich getan ist, wage ich nämlich zu bezweifeln. Gewiss, unsere Gesellschaft muss gerechter und ökologischer werden. Aber reicht ein Quäntchen mehr an Gerechtigkeit aus? Die Krise, in der wir stecken, wird meines Erachtens sträflich unterschätzt. Die Verwerfungen des internationalen Finanzsystems und der daraus resultierende Abwärtstrend der Realwirtschaft sind nur die Symptome, nicht die eigentliche Ursache der Misere. Bloß an den Symptomen herumdoktern könnte sich im Nachhinein als fataler Kunstfehler entpuppen. Im Grunde hoffen doch die meisten, dass es nach ein oder zwei Jahren des wirtschaftlichen Abschwungs auf den eingefahrenen Gleisen weitergeht wie bisher. Ob man das in Rom anfangs auch geglaubt hat? Wir könnten uns, ohne dass wir uns dessen bewusst sind, am Beginn eines lang anhaltenden Niedergangs befinden, denn Gesellschaften sind, einmal aus dem Lot gekommen, nur mit Mühe wieder zu stabilisieren. Nicht selten befinden sie sich anschließend auf einem tieferen gesellschaftlichen Niveau als vorher. Andere übernehmen dann das Ruder. So erging es etwa China, dessen Führungsrolle der Westen übernahm. China, Anfang des 15. Jahrhunderts: Im dritten Regierungsjahr des Ming-Kaisers Zhu Di verließ eine Flotte, wie sie die Welt bis dahin noch nie gesehen hatte, die Hafenstadt Liujia und läuft ins Südchinesische Meer aus. Sie umfasste 317 Schiffe (die legendäre spanische Armada, mit der Philipp II. gut 180 Jahre später England erobern wollte, kam "nur" auf 132 Schiffe). In ihrer Mitte befanden sich 62 Neunmaster - bis zu 135 Meter lang und 55 Meter breit (die Santa Maria, das Flagschiff Kolumbus', mit dem er 1492 Amerika entdeckte, war lediglich 25 Meter lang und 8 Meter breit). Insgesamt trug die chinesische Flotte 28.000 Soldaten. Die See-Expeditionen (1405 - 1433) standen unter dem Befehl des Eunuchen Zheng He und kamen im Westen bis nach Dschidda (im heutigen Saudi-Arabien) und Malindi (im heutigen Kenia). Die Chinesen erfanden unter anderem den Kompass (4. Jh. v. Chr.), das Papier (ca. 2. Jh. v. Chr.), das Porzellan (620 n. Chr.), den Buchdruck (erste Hälfte des 8. Jh. n. Chr.), das Schießpulver (850 n. Chr.) und die Kanone (um 1250 n. Chr.). Sie konnten bereits im 4. Jahrhundert v. Chr. (!) mit ihren Hochöfen Gusseisen erzeugen und produzierten Ende des 11. Jahrhunderts 125.000 Tonnen Roheisen (Großbritannien erreichte dieses Quantum erst 700 Jahre später). Schon im 5. Jahrhundert n. Chr. entwickelten sie ein Verfahren zur Stahlherstellung, mit dem das Siemens-Martin-Verfahren von 1864 vorweggenommen wurde. Im 12. Jahrhundert nutzten sie mit Wasserkraft betriebene Maschinen zum Spinnen von Hanf (rund 500 Jahre vor der britischen Textilindustrie). China war also in vielen Bereichen führend. Sogar mit großem Abstand, wie wir sehen. [3] Warum, so lautet die berechtigte Frage, haben dann die Europäer die Welt erobert und nicht die Chinesen? Die Antwort ist komplex, aber eine Ursache ist zweifellos im Bildungsverfall zu suchen. Das Reich der Mitte beschloss nämlich, die See-Expeditionen aufzugeben und sich von der Außenwelt weitgehend abzuschotten. China genügte sich selbst und verpasste so den Anschluss: Entwicklungen in anderen Regionen wurden nicht wahrgenommen bzw. bewusst ignoriert, die Wissenschaft aufgrund gesellschaftlicher Erstarrung und politischer Despotie nicht konsequent genug weiterentwickelt. Kurzum, es waren die Chinesen selbst, die ihren enormen Vorsprung verspielten. Sie fielen daher - relativ zu anderen - zurück, was sich später bitter rächen sollte, als die lernbereiten Europäer als Eroberer auftraten. Warum kommen Gesellschaften nach einschneidenden negativen Veränderungen so schwer wieder auf die Beine? Es liegt am Aufwand, den man dazu betreiben muss. Außerdem an den zwischenzeitlich gewachsenen Widerständen. Lassen Sie mich das anhand einer Analogie aus dem Bereich der Physik näher erläutern: Unsere Welt ist von physikalischen Feldern durchzogen, die sich auf das Verhalten von Elementarteilchen auswirken. In der nachfolgenden Grafik repräsentiert der grüne Untergrund die Geometrie eines solchen Feldes. Die Elementarteilchen, dargestellt durch die rote bzw. blaue Kugel, befinden sich auf einem jeweils von der Topologie des Feldes vorgegebenen Energieniveau, sie können sich im Feld nur entlang dieser Topologie bewegen. Nehmen wir an, die Kugeln sind menschliche Gesellschaften. Manchmal rumort es in ihnen, aber sie verlieren wegen kleinen Turbulenzen (Pfeil A) nicht ihr übliches Niveau. Grund: Die Energie der Störungen ist zu gering, um den Wulst des Randes zu überwinden. Sind die gesellschaftlichen Turbulenzen jedoch heftiger (Pfeil B), ist die Energie unter Umständen ausreichend, das Hindernis zu überwinden und auf ein niedrigeres Niveau zu fallen. Dort angelangt, wäre eine ungleich höhere Energie notwendig, um auf das alte Niveau zurück zu kommen. Deshalb verharren manche Gesellschaften nach dem Zerfall auf dem tieferen Niveau (rote Kugel). Selbstverständlich führen gesellschaftliche Turbulenzen nicht zwingend zu einem Niveauverlust. Abrupte Veränderungen, wie etwa die Französische Revolution, heben das Niveau gelegentlich sogar enorm an. Lassen Sie sich daher von der Topologie des Feldes in der Grafik nicht irritieren, das Ganze ist nur ein Beispiel. 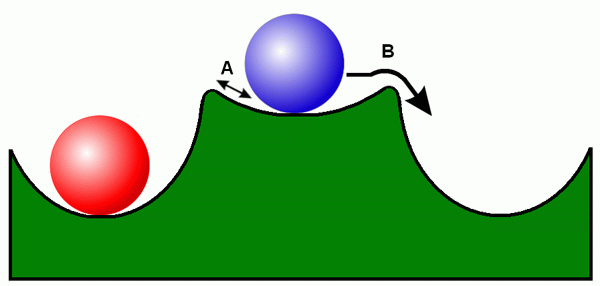 Wo befinden wir uns momentan? Ist die gegenwärtige Wirtschaftskrise mit Turbulenz A oder mit Turbulenz B vergleichbar? Befinden wir uns womöglich schon auf dem Wulst des Randes? Stürzen wir unweigerlich in den Abgrund? Das Gefährliche ist die Ungewissheit, allein das belegt den Ernst der Lage. Noch schlimmer: Die etablierten politischen Parteien machen keineswegs den Eindruck, sich dessen bewusst zu sein. Anders lässt sich das kleinkarierte Hickhack, das in der schwarz-roten Koalition vorherrscht, nicht erklären. Auch die Römer sind letztlich am Egoismus und an der Blindheit ihrer Politiker gescheitert. Immerhin können wir - zumindest potentiell - selbst bestimmen, in welche Richtung es gehen soll. Bundestagswahlen waren den Römern unbekannt. Es ist müßig zu fragen, ob gleiche, allgemeine und freie Wahlen das Römische Reich gerettet hätten, dazu war die Zeit einfach noch nicht reif. [4] Wie reif wir sind, wird sich spätestens am 27. September 2009 zeigen. ---------- [1] Wikipedia, Römisches Reich, Die Revolutionszeit und die Bürgerkriege [2] Kriegsreisende, Niedergang und Ende Roms, Vom Bürgerheer der Republik zur Söldnerarmee des Imperiums [3] David S. Landes, Wohlstand und Armut der Nationen, Berlin 2002, und Konrad Seitz, China, München 2006 [4] vgl. Wikipedia, Ausübung der Regierungsgewalt in der römischen Republik |
