
| Home | Archiv
| Impressum 19. August 2009, von Michael Schöfer Der schleichende Verfall Detroit, Michigan/USA - in der einstmals blühenden Industriestadt (Spitzname: Motor City) sieht es heute teilweise aus wie in Nachkriegsdeutschland: Ruinen von Industrie-, Geschäfts- und Wohngebäuden prägen ganze Stadtviertel. Die Einwohnerzahl Detroits hat sich zwischen 1950 (1,8 Mio.) und 2006 (0,9 Mio.) halbiert. "Die Stadt gleicht im Stadtzentrum einer Geisterstadt. Viele Häuser stehen leer und verfallen zunehmend, auf den Straßen sind ab dem frühen Abend nur wenige Menschen unterwegs, die Stadt wirkt fast tot." [1] Folge des Niedergangs der amerikanischen Automobilindustrie. Der ökonomische Strukturwandel trifft ganze Städte, Regionen und Länder. Nicht alle so hart wie Detroit, doch fast immer ist das Ganze mit enormen sozialen Problemen verbunden. In den klassischen Industriestaaten ist die Bedeutung der Industrie für die Wertschöpfung stark gesunken. In Großbritannien, dem Mutterland der Industrialisierung, schrumpfte der Anteil der Industrie am Bruttoinlandsprodukt zwischen 1970 und 2007 um mehr als die Hälfte (von 36,3 % auf 16,7 %). Im Gegensatz dazu ist die Bedeutung des Dienstleistungssektors gestiegen. "Unternehmensbezogene und Finanzdienstleistungen" haben mittlerweile (2007) einen Anteil von 31,9 Prozent erreicht. [2] Strukturwandel sei notwendig und überdies nicht zu verhindern, lautet der allgemeine Tenor. Beispiel Landwirtschaft in Deutschland: "Um 1900 erzeugte ein Landwirt Nahrungsmittel für 4 weitere Personen, 1950 ernährte er 10 Personen, 2004 waren es 143. (...) Durch Produktionsfortschritt und zunehmende Industrialisierung und Entwicklung des Dienstleistungssektors sank in den letzten 100 Jahren der Erwerbstätigenanteil in der Landwirtschaft von 38 % auf gut 2 %." [3] Getrieben vom Produktivitätsfortschritt hat eine Volkswirtschaft gar keine andere Chance, als sich fortwährend anzupassen. Durch Innovationen neue Bereiche erschließen, weil in den alten über kurz oder lang die Beschäftigungs- und Profitmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Mit anderen Worten: Wer stehen bleibt, verliert. Hätte man sich vor 100 Jahren entschlossen, mit aller Gewalt den Beschäftigungsstand in der Landwirtschaft zu halten, wäre Deutschland heute sicherlich kein Exportweltmeister. Das ist die eine Seite der Medaille. Andererseits müssen die Menschen natürlich in neuen Sektoren Arbeit und Einkommen finden. Lange Zeit fing die sich rasant entwickelnde Industrie die in der Landwirtschaft überflüssigen Arbeitskräfte auf. Da zwischenzeitlich aber auch die Industrie peu à peu an Bedeutung verliert, liege die Zukunft im Dienstleistungssektor, behaupten viele. Doch stimmt das wirklich? Kann eine Gesellschaft tatsächlich überwiegend von Dienstleistungen leben? Andersherum: Kann eine moderne Gesellschaft auf eine produzierende Industrie weitgehend verzichten? Ist die schleichende Deindustrialisierung nicht gleichbedeutend mit einem schleichenden Verfall? Der Rückgang des Anteils der Industrie an der Wertschöpfung ist beängstigend. 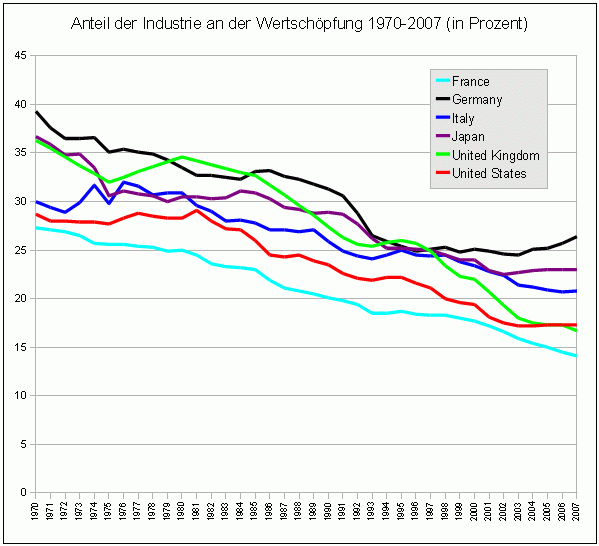
Die Finanzbranche ist für die britische Volkswirtschaft von großer Bedeutung: "324.000 Mitarbeiter finden allein in London im Finanzgeschäft Lohn und Brot." [5] "2005 wurden an der London Stock Exchange (LSE) 43 Prozent des internationalen Aktienhandels abgewickelt, in New York 31 Prozent. Auch bei den Neunotierungen liegt die LSE vorn. 17,2 Prozent aller Börsengänge fanden im Jahr 2006 in London statt, 16,8 Prozent an der Wall Street. In London gibt es mehr ausländische Banken als in New York, der Versicherungsmarkt ist mittlerweile fast doppelt so groß. (…) Noch Mitte der achtziger Jahre erwirtschaftete die Industrie mehr als 25 Prozent des britischen Bruttosozialprodukts und stand für mehr als 30 Prozent aller Jobs. Heute arbeiten in Industrie und Baugewerbe nur noch knapp 15 Prozent der Briten, aber mehr als 20 Prozent im Finanzsektor und mehr als ein Drittel in anderen Branchen des Dienstleistungssektors, die direkt von der City abhängen. Während Großbritanniens Bruttoinlandsprodukt in den vergangenen 20 Jahren um 66 Prozent wuchs, legte die City um 158 Prozent zu." [6] Die Hoffnungen, die man auf den Finanzsektor setzte, sind allerdings in der globalen Finanzkrise zerplatzt wie Seifenblasen. Zumindest vorerst. Die schleichende Deindustrialisierung führt, anders als uns die neoliberal orientieren Denkfabriken weismachen wollen, zu einem drastischen Verfall der Löhne. Besonders hierzulande: "Die Netto-Reallöhne sind in Deutschland seit Anfang der 90er Jahre kaum gestiegen. Von 2004 bis 2008 gingen sie sogar zurück, eine in der Geschichte der Bundesrepublik einmalige Entwicklung, denn nie zuvor ging ein durchaus kräftiges Wirtschaftswachstum mit einer Senkung der realen Nettolöhne über mehrere Jahre einher", stellte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) jüngst fest. "Dieser Befund ist umso bemerkenswerter, als sich die Qualifikation der beschäftigten Arbeitnehmer im Durchschnitt erhöht hat, was für sich genommen einen deutlichen Anstieg der Verdienste hätte erwarten lassen. Im Gegensatz zur Lohnentwicklung sind die Einkommen aus selbständiger Tätigkeit sowie aus Kapitalvermögen in den vergangenen Jahren kräftig gestiegen, sodass die Arbeitnehmerentgelte einen immer geringeren Teil des Volkseinkommens ausmachen. Die bereinigte Lohnquote erreichte 2007 und 2008 mit rund 61 Prozent ein Rekordtief." [7] Eine keineswegs neue Erkenntnis und zweifellos eine Folge der Ausweitung des Niedriglohnsektors, der Agenda 2010 und der Standort-Propaganda von INSM, Hans-Werner Sinn & Co. Auch in den USA ist die Einkommensungleichheit größer denn je: "Der Anteil der reichsten 10 Prozent der Amerikaner am Gesamteinkommen ist auf fast 50 Prozent angestiegen. (…) Die reichsten 10 Prozent der Amerikaner erzielen nun mit 49,7 Prozent fast die Hälfte des Gesamteinkommens. In den 70er Jahren lag der Anteil erst bei 33 Prozent. (…) Die Ungleichheit ist aber auch innerhalb der Gruppe der Reichen gestiegen. Die obersten 0,01 Prozent der Topverdiener - 14.988 Familien, die ein jährliches Einkommen von mindestens 11,5 Millionen US-Dollar erzielen - haben nun einen Anteil von 6 Prozent am Gesamtvermögen. Zu Beginn der Präsidentschaft von Ronald Reagan Anfang der 80er Jahre lag der Anteil noch bei einem bescheidenen Anteil von einem Prozent." [8] Die Neoliberalen haben es irgendwie geschafft, uns die Deindustrialisierung und die damit verbundenen "strukturellen Anpassungen" schmackhaft zu machen. Ruinen in Detroit, Kalifornien faktisch pleite, Verzweiflung bei Hartz IV-Empfängern, eine zum Himmel schreiende Vermögens- und Einkommensungleichheit - aber milliardenschwere Rettungspakete für inkompetente Nadelstreifenträger. Seltsam, kaum jemand scheint sich dagegen aufzulehnen. Im Gegenteil, die FDP hat gute Aussichten, nach der Bundestagswahl auf der Regierungsbank zu landen. Also ausgerechnet diejenigen, die bis zum Erbrechen das neoliberale Dogma gepredigt haben. Stoff für Verschwörungstheorien? Wohl kaum, aber Anlass zum Nachdenken. ---------- [1] Wikipedia, Detroit, Geschichte [2] Eurostat, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, VGR Aggregate und Erwerbstätigkeit nach Wirtschaftsbereichen, Bruttowertschöpfung - Unternehmensbezogene und Finanzdienstleistungen [3] Wikipedia, Landwirtschaft, Deutschland [4] Jürgen Elsässer, Fiktives Kapital, realer Krieg, April 2009 [5] FAZ vom 07.05.2009 [6] Die Zeit vom 27.09.2007 [7] DIW, Wochenbericht Nr. 33/2009 vom 12.08.2009, PDF-Datei mit 1,1 MB [8] Telepolis vom 17.08.2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
