
| Home
| Archiv
| Impressum 15. September 2009, von Michael Schöfer Eintrittsgeld Im Freibad muss man Eintrittsgeld bezahlen, in Museen ebenfalls und manchmal sogar in Stadtparks. Das ist völlig normal. Demnächst wollen aber auch die USA Eintrittsgeld verlangen - und zwar von Touristen. Der US-Kongress hat soeben mit großer Mehrheit eine Vorlage gebilligt, wonach Touristen künftig bei der Einreise in die USA eine Einreisegebühr in Höhe von 10 Dollar (z. Zt. 6,84 Euro) abverlangt werden soll. Paradoxerweise will man damit den Tourismus fördern. Ob das wirklich gelingt, wird man sehen. Viel gefährlicher ist das "Eintrittsgeld", das die USA neuerdings für chinesische Reifen verlangen, sie haben nämlich gerade auf deren Import Strafzölle von bis zu 35 Prozent verhängt. "17 Prozent aller Reifen in den USA stammen nach US-Presseberichten inzwischen aus China. In den ersten sieben Monaten 2009 sind demnach chinesische Reifen für 1,3 Milliarden US-Dollar (rund 893 Millionen Euro) in die USA exportiert worden." [1] China hat bereits Vergeltungsmaßnahmen angekündigt und will unfaire Praktiken der USA beim Export von Autoteilen und Hühnerfleisch prüfen. Gefährlich ist das Ganze deshalb, weil solche Handelshemmnisse zur Unzeit kommen, schließlich ist die Welt in der tiefsten Wirtschaftskrise seit den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Auch nach dem Crash von 1929 reagierte man mit protektionistischen Maßnahmen, was dann prompt in die "Große Depression" mündete. "Als fatal erwies sich das riesige Handelsbilanzplus der USA. Defizitländern blieben drei Möglichkeiten: mehr in die USA zu exportieren, Importe einzuschränken oder ihre Kredite nicht mehr zu bedienen. Die erste Möglichkeit wurde von Präsident Herbert Hoover durch eine drastische Anhebung der Zölle verhindert. Blieben nur die Optionen zwei und drei - der Welthandel brach zusammen, die Depression fegte über die Erdkugel hinweg." [2] "Die USA betrieben (...) eine Politik des 'America first', die schließlich auch für andere Staaten eine protektionistische Signalwirkung hatten. Ähnlich verhielt sich Großbritannien (...) - getreu dem Motto 'Britain first, Empire second, foreigners last'" [3] Zwar streiten die Gelehrten, ob der Protektionismus die alleinige Schuld an der Verschärfung der Wirtschaftskrise im Nachgang des Börsenkrachs von 1929 trägt, doch hat er die prekäre Lage zweifellos enorm verschärft. Man muss kein stupider Anhänger des unregulierten Freihandels sein um festzustellen: Die damalige Reaktion der Politiker war intuitiv naheliegend, aber, wie wir heute wissen, absolut falsch. Dass die USA in der jetzigen Situation erneut damit beginnen, lässt Schlimmes ahnen. Klug ist ihr Verhalten jedenfalls nicht, denn das Geplänkel könnte zu einem veritablen Handelskrieg ausarten. Bekanntlich schaukeln sich kleine Konflikte hin und wieder mächtig auf, weil sie eine gefährliche Eigendynamik entwickeln. Andererseits leiden die Vereinigten Staaten unter einem chronischen Handelsbilanzdefizit, während andere Länder, insbesondere China und Deutschland, riesige Außenhandelsüberschüsse erwirtschaften. Vergleichen wir die drei Staaten mit dem höchsten Plus und die drei Staaten mit dem größten Minus, dann wird auf den ersten Blick klar, worum es geht.
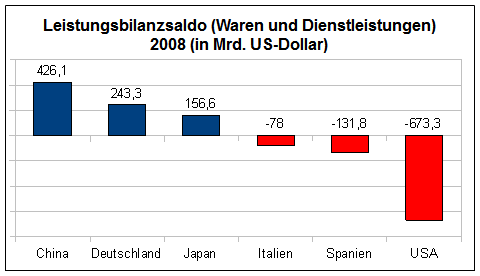 Dabei sind das nur die Zahlen aus einem einzigen Jahr. Seit 1975, dem letzten Jahr mit einer positiven Außenhandelsbilanz, importieren die USA mehr als sie exportieren. Da hat sich mittlerweile einiges angesammelt: ein Minus von insgesamt 7,1 Billionen US-Dollar. Finanziert wird das Defizit durch Kapitalimport aus dem Ausland, insbesondere die Chinesen legen in Amerika ihre gewaltigen Außenhandelsüberschüsse an und kaufen massenhaft Staatsanleihen. Im Grunde können sich beide einen Handelskrieg gar nicht leisten. Aber wenn es auf der Welt immer rational zuginge, würde vieles nicht passieren.
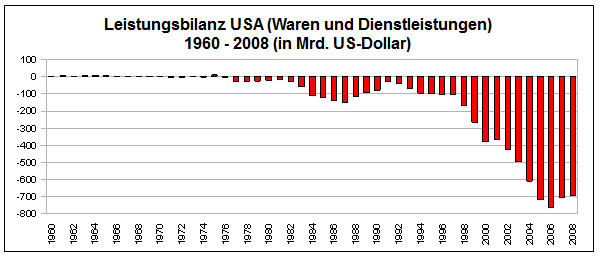 Es ist also nicht damit getan, protektionistische Maßnahmen zu verurteilen, vielmehr müsste man die großen Handelsungleichgewichte aktiv bekämpfen. Nicht einseitig, sondern gemeinsam. Doch genau hierbei hakt es, insbesondere in Deutschland. Das "Geschäftsmodell" Deutschlands ist der Export, der Binnenmarkt liegt hingegen mangels Kaufkraft danieder. Folge sinkender Reallöhne. Das Geschäftsmodell Deutschlands beruht faktisch auf dem Export von Arbeitslosigkeit, gleichzeitig übt es - namentlich innerhalb der Euro-Zone - Druck auf die Lohnentwicklung anderer Länder aus. Die positiven Handelsbilanzsalden der Vergangenheit sind hierfür Beleg genug. Der Titel "Exportweltmeister" ist keine Zierde, er ist ein Problem. Deutschland müsste demzufolge sein Geschäftsmodell überdenken, weniger auf den Export setzen und zum Ausgleich die Binnenkonjunktur ankurbeln. Allerdings will man offenbar rasch zu den Verhältnissen vor der Finanzkrise zurückkehren: der starken Exportorientierung. Ein Beispiel: Die Abwrackprämie hat der Automobilindustrie vorübergehend eine Atempause verschafft, doch damit ist es nun nach deren Auslaufen vorbei. "Experten rechnen nach dem Wegfall der staatlichen Anreize (...) mit einem Rückgang der Pkw-Zulassungszahlen im nächsten Jahr um eine Million auf 2,8 Millionen Einheiten." [4] Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), hofft jedoch auf einen sich erholenden Absatzmarkt jenseits der Grenzen. "Um die entstehende Lücke zu stopfen, setzt der VDA auf den Export, der sich nach den herben Einbrüchen in den vergangenen Monaten leicht erholt hat." [5] "Wenn sich der Export stabilisiert, werden wir das Delta ausgleichen können", sagt Wissmann. [6] Das heißt in der Konsequenz: Weiter so wie bisher. Von Umdenken keine Spur. Natürlich ist die deutsche Automobilindustrie traditionell exportorientiert. An den zurückgehenden Absatzzahlen auf dem Binnenmarkt war freilich nicht allein die Finanzkrise schuld, es gab auch schon vorher Absatzprobleme. So ist hierzulande der durchschnittliche Neuwagenpreis zwischen 1991 und 2007 von 15.290 Euro auf 25.970 Euro gestiegen. Das ist ein Plus von 69,8 Prozent. [7] Die Nettoverdienste je Arbeitnehmer und Jahr sind im gleichen Zeitraum von 13.688 Euro auf lediglich 17.689 Euro angewachsen. Das ist ein Plus von 29,2 Prozent. [8] Es war also seit langem klar, dass es mangels Kaufkraft beim Pkw-Verkauf irgendwann zu einem herben Einbruch kommen musste. Die Finanzkrise hat das Ganze bloß beschleunigt.  Das Eintrittsgeld zu erhöhen, ob für Touristen, Fahrzeugreifen oder Hühnerfleisch, ist der falsche Weg. Die Gefahr, dass es daraufhin zu einem noch größeren Crash kommt, ist angesichts der historischen Erfahrungen nicht von der Hand zu weisen. Ungeachtet dessen ist klar, es muss sich etwas ändern. Wer von den USA erwartet, eine weiter zunehmende Auslandsverschuldung stoisch wegzustecken und dabei zwangsläufig den Überschussnationen Deutschland und China wie gehabt die Handelsbilanz aufzupolieren, versteht nichts von Wirtschaft. Und nichts von Menschen, die sich dem gewiss heftig widersetzen werden. Wenn wir trotzdem an diesem fatalen Kurs festhalten, holt uns die ökonomische Wahrheit früher oder später ein. ---------- [1] Welt-Online vom 14.09.2009 [2] Ariva.de vom 13.10.2006 [3] Christian Kleinschmidt: Rezension zu: James, Harold (Hrsg.): The Interwar Depression in an International Context. München 2002. In: H-Soz-u-Kult, 29.10.2002 [4] Reuters vom 14.09.2009 [5] Focus-Money vom 02.09.2009 [6] Motorzeitung vom 14.09.2009 [7] DAT-Report 2008, Seite 13, PDF-Datei mit 4 MB [8] Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Statistisches Taschenbuch 2008, Tabelle 1.14, Ecxel-Datei mit 80 kb |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
