
| Home | Archiv
| Impressum 25. November 2009, von Michael Schöfer Wetterleuchten Weltreiche kommen und gehen, viele sind nahezu vergessen. Wer erinnert sich denn noch an die Hethiter, die im 2. Jahrtausend v. Chr. in der heutigen Türkei ein Großreich aufbauten? Niemand, außer vielleicht ein paar Historiker oder Archäologen. Das klassische Beispiel für den Niedergang eines Staatswesens ist sicherlich das Römische Reich, das immerhin mehr als tausend Jahre überdauerte (Westrom von 750 v. Chr. bis 476 n. Chr). Hätte man zur Zeit von Trajan (Regentschaft von 98 bis 117 n. Chr.), unter dem Rom seine größte territoriale Ausdehnung erreichte, einen Römer gefragt, ob er sich den Untergang des Reiches vorstellen kann, hätte er gewiss mit einem klaren Nein geantwortet und im vollen Brustton der Überzeugung versichert: "Rom besteht ewig." Es kam bekanntlich anders. Warum sind Weltreiche zerfallen? Als Ursachen kommen u.a. kultureller Niedergang, militärische und/oder ökonomische Überdehnung, Eroberung durch äußere Feinde sowie gesellschaftliche Stagnation in Frage. Oft ist es ein Mix aus allem. Über lange Zeiträume hinweg registriert man ein ständiges Auf und Ab der Kulturen. So hat sich etwa die westliche Kultur seit der Renaissance (14. - 17. Jahrhundert) peu à peu emporgearbeitet und beherrscht seitdem das Weltgeschehen. Doch immer wieder finden sich Herausforderer, die mit der bisherigen Machtverteilung unzufrieden sind und einen größeren Anteil am Kuchen einfordern. Das ist verständlich, keiner sitzt gerne in der zweiten Reihe. Neuerdings wird China im Westen mehr und mehr als Konkurrent empfunden. Die ökonomische Entwicklung der Volksrepublik seit Deng Xiaopings Machtübernahme ist ohne Zweifel enorm. Wenngleich dort nicht alles Gold ist was glänzt, darf man den Chinesen eine beeindruckende Dynamik attestieren. 1973 lag der Anteil Chinas am Weltexport bei lediglich einem Prozent, 2008 waren es schon 9,1 Prozent. [1] Mittlerweile steht die Volksrepublik auf der Rangliste der Staaten mit dem größten Bruttoinlandsprodukt auf Platz drei. [2] Auf der Liste der Länder mit dem höchsten Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt sieht das zwar nach wie vor bescheiden aus (Ranglistenplatz 105), dennoch sollte keiner das wiedererwachte "Reich der Mitte" unterschätzen. Ich will hier gar nicht wie Samuel P. Huntington (The Clash of Civilizations) darüber spekulieren, ob es dereinst zum "Kampf der Kulturen" (China versus USA) kommen wird. Dieser ist bei kluger Politik durchaus vermeidbar, obgleich Reiche wegen ihres kolossalen Ressourcenbedarfs fast immer expandieren müssen oder andere wenigstens beherrschen wollen. Es muss also keineswegs, was manche prophezeien, unausweichlich zum großen Krieg der Rivalen kommen. Es geht mir hier vielmehr um die Konkurrenzsituation im Allgemeinen, nicht bloß im Speziellen um die militärische. Übrigens: Huntington erwartete von den Chinesen keine aggressive Expansionspolitik. "Mit seltenen Ausnahmen wie möglicherweise dem Südchinesischen Meer ist nicht zu erwarten, daß die Hegemoniebestrebungen Chinas eine Ausweitung seiner territorialen Kontrolle durch direkten Einsatz militärischer Gewalt bedeuten." [3] Das chinesische Denken wurzle im Konfuzianismus, "und Hegemonialkriege europäischer Art fehlen in der Geschichte Ostasiens". (Seite 379f) Grob gesagt ist im Westen der Individualismus vorherrschend, während in Asien traditionell mehr die Gesellschaft im Vordergrund steht. Bei uns legt man großen Wert auf Menschenrechte und Demokratie, in China sind die Rechte des Einzelnen nebensächlich und demokratische Mechanismen gelten als entbehrlich. Jedenfalls bislang. Westliche Beobachter sagen immer, Demokratie und Menschenrechte kommen quasi von alleine mit der wirtschaftlichen Entwicklung, das sei so sicher wie das Amen in der Kirche. Man könne keine konkurrenzfähige Gesellschaft aufbauen, ohne zugleich geistigen Freiraum zu gewähren. China würde sich daher zwangsläufig dem Westen angleichen. Doch haben sie wirklich recht? Die Finanzkrise hat die Verwerfungen im westlichen Gesellschaftsentwurf deutlich hervortreten lassen. Ich möchte hier keinesfalls gegen Demokratie und Menschenrechte plädieren, ganz im Gegenteil, aber zumindest die Frage aufwerfen, ob die westliche Gesellschaft angesichts ihrer offenkundigen Deformation ihre Stellung halten kann. Maßlose Gier und die überproportionale Berücksichtigung von Partikularinteressen durch die Politik können ein Gemeinwesen von innen heraus ruinieren. Und zweifellos ist im Westen der Unterschied zwischen Arm und Reich in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch gewachsen. "50 Millionen Amerikaner hatten 2008 nicht genug zu essen", das sind immerhin ein Sechstel der Bevölkerung der Vereinigten Staaten. [4] Auch die Unfähigkeit der Politiker, das Spielkasino der Finanzmarkthasardeure zu schließen, könnte sich als fatal erweisen. Wenn selbst Wolfgang Schäuble sagt, "diese Raffgier zerstört alles, und mich stimmt sehr nachdenklich, dass sie schon wieder um sich greift", spricht das Bände. [5] Noch einen Crash wird unser System vermutlich nicht überleben. "Sollte sich die Krise wiederholen, könne das gesamte Gesellschaftssystem Schaden nehmen", fürchtet Angela Merkel. [6] Es muss sich vor diesem Hintergrund erst noch erweisen, ob der westliche Gesellschaftsentwurf langfristig tatsächlich der erfolgreichere ist. Das Modell verliert unbestreitbar an Attraktivität. Kann es wirklich eine ökonomische Entwicklung ohne Demokratie, freie Wahlen, Pluralismus und friedliche Machtwechsel geben? Können autoritäre Gesellschaften sogar die Vorherrschaft erringen? China probiert es gerade aus. Es wäre beruhigender, wenn es im Westen keine Zerfallserscheinungen gäbe, doch die sind unübersehbar. Dabei greift China im Grunde gar nicht an, es nutzt bloß die durch die westliche Selbstschwächung entstandene Lücke. Mit anderen Worten: Wir ruinieren uns durch eine törichte Politik ganz von alleine. Rom ging, wie wir heute wissen, entgegen allen zeitgenössischen Annahmen unter. Uns könnte das gleiche Schicksal drohen. Dies zu bestreiten, wäre vermessen. Solange wir eine offene, tolerante Gesellschaft bleiben, werden wir stets die notwendige Flexibilität zeigen, um alle Krisen zu meistern. Doch wie frei sind wir eigentlich? "90 Millionen Dollar ließen sich US-Konzerne die Lobbyarbeit [gegen den Klimaschutz] allein 2008 kosten. (...) 770 Unternehmen haben in den USA rund 2340 Souffleure angeheuert, um Druck auf Abgeordnete und Senatoren auszuüben - auf jeden Abgeordneten kommen vier Lobbyisten." [7] Und in der Finanzkrise wird im Buhlen um den Einfluss auf die Parlamentarier ebenfalls mit Riesensummen um sich geworfen: "Insgesamt spendete die Finanzindustrie seit Jahresbeginn 35 Mio. Dollar an amerikanische Kongressabgeordnete." [8] Kein Wunder, wenn sich die USA beim Klimaschutz extrem schwer tun. Kein Wunder, wenn die Wall Street auf dem Capitol Hill mächtige Freunde hat. Die Bürger, die sich keine teuren Lobbyisten leisten können, haben das Nachsehen. Genau das meinte ich, als ich von der überproportionalen Berücksichtigung von Partikularinteressen durch die Politik sprach. Ungleichgewichte können das beste Schiff zum Kentern bringen. Kehren wir noch einmal nach Rom zurück: Die Römische Republik überdauerte fast genau 500 Jahre (von 510 v. Chr. bis 27 v. Chr.), doch geriet sie ungefähr Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. in eine schwere innenpolitische Krise. "Die Römer pflegten einen Teil des im Krieg eroberten Landes in Staatsbesitz zu überführen und bedürftigen Bürgern zur Nutzung zu überlassen. Um Aneignung großer Agrargüter in den Händen einiger weniger zu vermeiden, war der Landbesitz offiziell auf 500 Iugera beschränkt worden. Dieses Gesetz konnte jedoch nicht durchgesetzt werden. Wohlhabende Bürger legten sich riesige Landgüter zu. Dies wurde spätestens zu dem Zeitpunkt zum Problem, als praktisch alles Land innerhalb Italiens verteilt war und gleichzeitig immer mehr Sklaven infolge der siegreichen Kriege ins Land strömten. Die Kleinbauern und Handwerker aus der Schicht der Plebejer konnten mit dem durch die zahlreichen Kriege stetig anwachsenden Sklavenheer nicht konkurrieren. Gleichzeitig waren sie durch die zahlreichen Kriege außerhalb Italiens zu langer Abwesenheit gezwungen, was den Erhalt des heimischen Hofes weiter erschwerte. Die Großgrundbesitzer hingegen vergrößerten ihren Landbesitz durch den Kauf unprofitabler Höfe oder auch durch gewaltsame Vertreibungen. Die Verarmung breiter Bevölkerungsschichten führte zu Landflucht und erheblicher Unzufriedenheit. Andere Gruppen von Plebejern, die im Handel zu Reichtum gekommen waren, verlangten nach mehr Rechten. Die nach den Brüdern Tiberius Sempronius Gracchus und Gaius Sempronius Gracchus benannte Gracchische Reform sollte die Grundbesitzverhältnisse reformieren und den ärmeren Schichten der Bevölkerung zu Land und Einkommen verhelfen. Die Reform scheiterte allerdings am Widerstand der konservativen Senatskreise." [9] Die Republik ging im Bürgerkrieg unter, nach ihr kam die Kaiserzeit. Doch auch das Ende der römischen Kaiserzeit kündigte sich frühzeitig an - und damit zugleich der Untergang des weströmischen Reiches. "Über diese Krise ist viel theoretisiert worden, ohne dass sich die Historiker jedoch völlig auf die Ursachen einigen konnten. Fest steht, dass im 3. Jahrhundert das Edelmetall knapp wurde und damit Steuer- und Finanzwesen fast vollständig zum Erliegen kamen. Es kam zu einer immer rascheren Inflation [ca. 270 n. Chr.] und schließlich zu einem vollständigen Zusammenbruch der Währung. (...) Das zentrale Problem war nach wie vor die ausstehende Landreform. Die Latifundien hatten sich seit den Tagen Sullas [138 - 78 v. Chr.] unaufhaltsam weiter vergrößert. So schrieb Plinius schon im 1. Jahrhundert, dass sich die Hälfte der Provinz Afrika in den Händen von 6 Großgrundbesitzern befinde! Da der Staat kaum noch über brauchbares Land verfügte, hatte man schon seit langem damit begonnen, die ausscheidenden Legionäre mit Geld abzufinden. Aber die reichen Senatoren blockierten nicht nur die Landvergabe, sie bezahlten für ihre Latifundien natürlich auch keine Steuern." [10] Den Rest erledigten die "Barbaren": 410 n. Chr. wurde Rom von den Westgoten geplündert, 455 n. Chr. von den Vandalen. Der letzte Kaiser Westroms verlor 476. n. Chr. die Regentschaft. Fazit: Die Römer sind letztlich am Egoismus und an der Blindheit ihrer Politiker gescheitert, ohne solche Zerfallserscheinungen hätten sie vielleicht dem äußeren Druck standgehalten. Detroit, die Heimatstadt von General Motors, ist in der westlichen Hemisphäre gewissermaßen ein Menetekel für die drohende Entwicklung. In der einstmals blühenden Industriestadt (Spitzname: Motor City) sieht es heute teilweise aus wie in Nachkriegsdeutschland: Ruinen von Industrie-, Geschäfts- und Wohngebäuden prägen ganze Stadtviertel. Die Einwohnerzahl Detroits hat sich zwischen 1950 (1,8 Mio.) und 2006 (0,9 Mio.) halbiert. "Die Stadt gleicht im Stadtzentrum einer Geisterstadt. Viele Häuser stehen leer und verfallen zunehmend, auf den Straßen sind ab dem frühen Abend nur wenige Menschen unterwegs, die Stadt wirkt fast tot." [11] In allen westlichen Industriestaaten ist der Anteil der Industrie an der Wertschöpfung seit 1970 dramatisch gesunken (siehe Grafik). 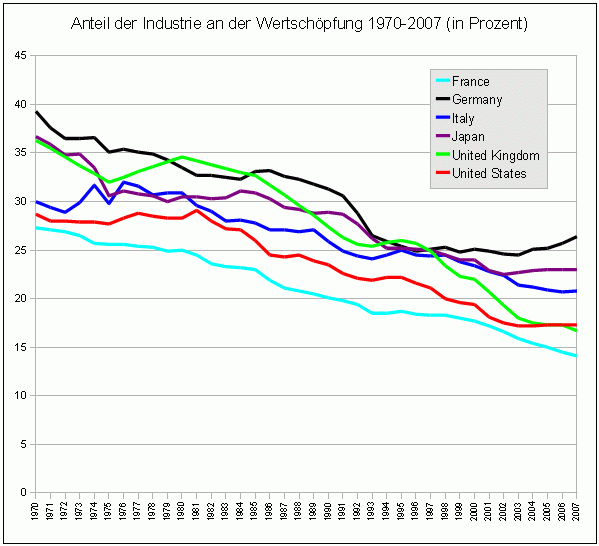
Die Neoliberalen haben es irgendwie geschafft, uns die schleichende Deindustrialisierung und die damit verbundenen "strukturellen Anpassungen" schmackhaft zu machen. Einerseits Ruinen in Detroit, Kalifornien faktisch pleite, in Deutschland zunehmende Verzweiflung bei Hartz IV-Empfängern, fast überall eine zum Himmel schreiende Vermögens- und Einkommensungleichheit, aber andererseits milliardenschwere Rettungspakete für inkompetente Nadelstreifenträger - bittere Wirklichkeit anno 2009. In Rom kämpfte Marcus Tullius Cicero (106 - 43 v. Chr.) mit bewundernswerter Eloquenz gegen den Verfall der Römischen Republik. "Der Staatsdienst muss zum Nutzen derer geführt werden, die ihm anvertraut werden, nicht zum Nutzen derer, denen er anvertraut ist. (…) Der Feind befindet sich in unseren Mauern. Gegen unsere eigenen Luxus, unsere eigene Dummheit und unsere eigene Kriminalität müssen wir kämpfen. (…) Keine Staatsform bietet ein Bild hässlicherer Entartung, als wenn die Wohlhabendsten für die Besten gehalten werden. (…) Jedem Menschen unterlaufen Fehler, doch nur die Dummen verharren im Irrtum." Worte, die auch nach mehr als 2000 Jahren nichts von ihrer Gültigkeit verloren haben. Bedauerlicherweise kämpfte Cicero vergebens und musste seinen Einsatz für die Republik am Ende sogar mit dem Leben bezahlen. Auch wenn Rom noch ein paar Jahrhunderte überlebte, war die Agonie des Reiches zu diesem Zeitpunkt bereits vorgezeichnet. Die Römer verharrten im Irrtum. Washington liegt nicht am Tiber, und Obama ist zum Glück nicht Caligula (bei George W. Bush wäre der Vergleich passender gewesen). Gleichwohl dürfen wir gewisse Parallelen, sozusagen das Wetterleuchten am Horizont, nicht übersehen. Dass die Demokratie siegt, dass sich Rechtsstaat, Gewaltenteilung und Pressefreiheit zu guter Letzt durchsetzen, ist nämlich keineswegs sicher. Das chinesische Modell ist insofern eine echte Herausforderung. ---------- [1] WTO, World merchandise exports by region and selected economy, Excel-Datei mit 57 kb [2] Wikipedia, Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt [3] Samuel P. Huntington, Kampf der Kulturen, München 1998, Seite 372 [4] Spiegel-Online vom 17.11.2009 [5] Süddeutsche vom 22.11.2009 [6] Süddeutsche vom 20.11.2009 [7] Süddeutsche vom 21.11.2009 [8] Süddeutsche vom 23.09.2009 [9] Wikipedia, Römisches Reich, Die Revolutionszeit und die Bürgerkriege [10] Kriegsreisende, Niedergang und Ende Roms, Vom Bürgerheer der Republik zur Söldnerarmee des Imperiums [11] Wikipedia, Detroit, Geschichte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
