
| Home
| Archiv
| Impressum 16. März 2010, von Michael Schöfer Streber mag keiner In fast jeder Schulklasse gibt es einen Überflieger, der von seinen weniger talentierten Mitschülern meist als gemeiner Streber verteufelt wird. Streber bekommen zwar immer die besten Noten und sind bei den Lehrern außerordentlich beliebt, die heißbegehrten Mädchen schleppen allerdings andere ab. Später stellt man dann fest, dass der Streber natürlich auch einen supertollen Job bekommen hat und jede Menge Kohle verdient. So sagt es zumindest das Klischee. Frankreichs Wirtschafts- und Finanzministerin Christine Lagarde mag ebenfalls keine Streber, und damit steht sie wohl nicht allein. Deutschland vernachlässige die heimische Nachfrage (sprich: die Importe) und der große Handelsüberschuss des Ex-Exportweltmeisters gefährde die Wettbewerbsfähigkeit der anderen Staaten der Eurozone, behauptet sie. Da ist durchaus etwas Wahres dran. 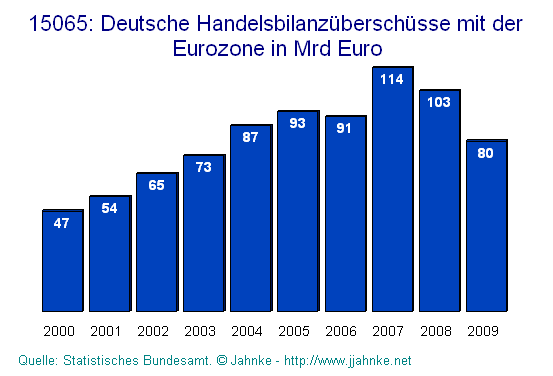 [Quelle: Infoportal Deutschland & Globalisierung, Rundbrief 15.03., mit freundlicher Genehmigung von Joachim Jahnke] Früher, d.h. vor der Währungsunion, wäre die unterschiedliche Entwicklung bei der Produktivität über Wechselkursanpassungen aufgefangen worden. Seit Einführung des Euro gibt es diesen Ausgleich jedoch nicht mehr. Jetzt verlieren Deutschlands Handelspartner und Konkurrenten auf dem Weltmarkt entweder peu à peu ihre Wettbewerbsfähigkeit, oder sie müssen die Produktivität entsprechend steigern. Das ist keine grundlegend neue Erkenntnis. Ganz im Gegenteil, genau vor dieser Entwicklung haben Ökonomen jenseits des neoliberalen Mainstreams bereits vor Jahren gewarnt. So etwa Heiner Flassbeck (unter Oskar Lafontaine von 1998 bis 1999 Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen) und Friederike Spiecker: "Wie
stellt sich die Situation innerhalb einer Währungsunion dar?
Welche Folgen hat ein Abweichen von der lohnpolitischen
Spielregel [1] durch ein einzelnes Mitgliedsland, wenn es
mangels eigener Währung kein Ab- bzw. Aufwertungsventil
gegenüber den Partnerländern der Währungsunion mehr gibt?
(...) Wer einmal über seine Verhältnisse lebt, verliert
Marktanteile, weil er teurer anbieten muss als die
ausländische Konkurrenz. Erst wenn eine Korrektur der
Lohnentwicklung in gleicher Höhe nach unten erfolgt, kann
die ursprüngliche Wettbewerbsfähigkeit zurückgewonnen
werden. Geschieht dies nicht, gerät das Land in die
Abhängigkeit seiner Währungsunionspartner, die ihm letzten
Endes Transfers zahlen müssen.
Wer einmal unter seinen Verhältnissen lebt, gewinnt hingegen Marktanteile von seinen Währungsunionspartnern. Das Land, das seinen Gürtel enger schnallt, als es der von der Zentralbank vorgegebenen Zielinflationsrate plus Produktivitätsfortschritt entspricht, segelt im währungspolitischen Windschatten seiner Währungsunionspartner: Es muss nicht wie im Fall flexibler Wechselkurse mit einer nominalen Aufwertung rechnen, die die reale Unterbewertung seiner Währung korrigiert und damit den Wettbewerbsvorteil zunichte macht. Doch das Unter-den-eigenen-Verhältnissen-Leben hat selbstverständlich binnenwirtschaftliche Konsequenzen. Der private Verbrauch muss sich auf langsamer wachsende reale Arbeitseinkommen stützen, was die von der inländischen Nachfrage abhängigen Branchen in Bedrängnis bringt. Letzten Endes müssen die Unternehmen auf die schwächere Nachfrageentwicklung im Inland mit geringeren Preissteigerungen als ursprünglich geplant oder sogar mit Preisnachlässen reagieren. Dabei kann die günstigere Entwicklung der Exporte die dämpfende Wirkung einer zurückhaltenden Lohnpolitik auf Dauer nicht ausgleichen, wenn der private Verbrauch ein größeres Gewicht als der Außenhandel (Export und Importsubstitution) hat. Unabhängig davon gilt aber in jedem Fall, dass die dauerhafte Verschuldung des Auslands beim Land des Gürtel-enger-Schnallens gerade auch in einer Währungsunion dieser Strategie eine klare Grenze setzt, nämlich die der Zahlungsfähigkeit und des Übergangs in eine Transferunion, also in eine Gemeinschaft, in der die vor der Zahlungsunfähigkeit stehenden Länder von den restlichen Ländern der Gemeinschaft freigehalten werden." [2] Die beschriebene Entwicklung ist ja nun eingetreten: Die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Partnerstaaten ist evident, der Anpassungsdruck bei den Löhnen daher riesengroß. Anpassungsdruck nach unten, versteht sich, denn in Deutschland sinken die Reallöhne schon seit langem. Das wird sich aller Voraussicht nach in Zukunft auch nicht ändern. Die CDU-geführte Bundesregierung weigert sich nämlich hartnäckig, einen gesetzlichen Mindestlohn einzuführen, der den Verfall der Löhne bremsen könnte. Von anderen Maßnahmen ganz zu schweigen. Kurzum, Deutschland wird weiter den allseits ungeliebten Streber spielen. Und obendrein den Lehrmeister. Die Misere Griechenlands ist zweifellos zu einem Gutteil hausgemacht. Aber es ist trotzdem nicht damit getan, den Griechen jetzt bloß eine Politik des Gürtel-enger-Schnallens zu verordnen. Griechenland muss schließlich - volkswirtschaftlich betrachtet - irgendwann auch wieder Einnahmen generieren, andernfalls fallen dort die Löhne ins Bodenlose. Helfen könnte u.a., wenn Deutschland mehr aus Griechenland importieren würde (anstatt den Griechen sündhaft teure Kampfflugzeuge anzubieten). Um hierzulande die Importe anzukurbeln, müssten freilich die Löhne steigen, denn Löhne bedeuten bekanntlich Kaufkraft. Leider, und wir werden es nach der NRW-Wahl bestimmt erleben, wird Deutschland auf Teufel komm raus sparen. Wo? Selbstverständlich bei den Arbeitnehmern und im Sozialbereich. Kurzum, die Krise wird dadurch kaum behoben, sondern womöglich sogar noch verschärft. ---------- [1] Spielregel für die Lohnpolitik: Die Nominallöhne müssen im Durchschnitt einer Volkswirtschaft so steigen wie die Summe aus gesamtwirtschaftlichem Produktivitätswachstum und der von der Gesellschaft im einheitlichen Währungsraum gewünschten Inflationsrate. Dann steigen die gesamtwirtschaftlichen Lohnstückkosten in Höhe der Zielinflationsrate. [2] Heiner Flassbeck / Friederike Spiecker, Die deutsche Lohnpolitik sprengt die Europäische Währungsunion, in WSI Mitteilungen 12/2005, PDF-Datei mit 132 kb Nachtrag (23.03.2010): Lesenswerter Beitrag zum Thema: "Für Fortgeschrittene" von Robert von Heusinger Das Geheimnis unseres auf Schulden basierenden Geldsystems lautet: "Der Gläubiger muss es seinem Schuldner ermöglichen, die Schulden zurück zu zahlen. Er muss ihn zahlungsfähig halten." [3] [3] Herdentrieb vom 21.03.2010 |
