
| Home | Archiv
| Impressum 06. März 2011, von Michael Schöfer Von allen guten Geistern verlassen Der Chef der Europäischen Zentralbank, Jean-Claude Trichet, hat vergangene Woche angekündigt, im April die Zinswende einzuleiten. Momentan liegt der EZB-Leitzins bei 1,0 Prozent. Grund für die angestrebte Leitzinserhöhung sei der starke Teuerungsdruck, ließ Trichet verlauten. Die Inflationsrate in der Euro-Zone lag im Februar bei 2,4 Prozent und damit erneut über dem Zielwert von zwei Prozent. [1] Haupttriebfeder der anziehenden Preisentwicklung ist die unsichere Lage im Nahen Osten, die den Ölpreis abrupt in die Höhe trieb. 
Erdöl, Preisanstieg in den letzten sechs Monaten
[Quelle: mit freundlicher Genehmigung von www.finanztreff.de] Außerdem steigen die Preise für Nahrungsmittel. Nach Angaben der FAO (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen) sind diese auf eine "Verknappung des weltweiten Getreideangebots aufgrund steigender Nachfrage und eines Rückgangs der weltweiten Getreideproduktion im Jahr 2010" zurückzuführen. Darüber hinaus seien die Getreidevorräte stark gesunken. [2] 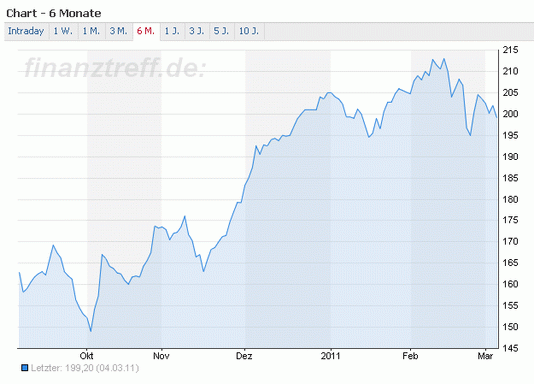
Weizen, Preisanstieg in den letzten sechs Monaten
[Quelle: mit freundlicher Genehmigung von www.finanztreff.de] Man fragt sich unwillkürlich: Was will Trichet mit der Leitzinserhöhung erreichen? Auf den Ölpreis und das knappe Nahrungsmittelangebot hat der Leitzins schließlich keinen Einfluss. Durch eine Zinserhöhung lässt sich zumindest diese Triebfeder der inflationären Entwicklung kaum eindämmen. Mit anderen Worten: Käme der weltgrößte Öllieferant Saudi-Arabien ins Straucheln, könnte die EZB zwar den Leitzins auf astronomische 500 Prozent anheben, doch dadurch würde der Ölpreis keinen einzigen Cent niedriger ausfallen. Die Folge wäre bloß der Kollaps der Wirtschaft. Kritiker befürchten denn auch eher den gegenteiligen Effekt: Die Leitzinserhöhung würde erstens die wirtschaftliche Erholung verzögern, wenn nicht gar völlig abwürgen. Man sollte nicht vergessen: Etliche EU-Länder fahren gerade einen brutalen Sparkurs, schon allein das wird sich beim Wirtschaftswachstum negativ bemerkbar machen. Und die Leitzinserhöhung käme noch hinzu. Zweitens verteuern sich die Refinanzierungskosten der ohnehin bereits angeschlagenen Euro-Länder (Irland, Griechenland, Portugal etc.), die dann für ihre Schulden höhere Zinsen zahlen müssten (außer, sie schlüpfen alle unter den EU-Rettungsschirm). Die Lage könnte sich mithin dramatisch verschärfen. Motto: "Inflation erfolgreich bekämpft, Patient tot." Nichtsdestotrotz, die Inflationsangst dominiert zur Zeit alles. Die enorme Liquidität, mit der die Zentralbanken die Geldinstitute gefüttert haben (Stichwort: Geldmenge), führe zwangsläufig zu einer erhöhten Inflationsrate, wird behauptet. Manche "Finanzexperten" malen gar das Schreckgespenst "Hyperinflation" an die Wand (was, ganz nebenbei, ihren Geschäften förderlich ist). Vor ein paar Jahren verkauften sie den Anlegern strukturierte Wertpapiere, die heute allerdings nahezu wertlos sind. Jetzt ermuntern sie ihre Klientel zur Flucht in die Sachwerte, damit die Anleger aus dem Krater, den die einst empfohlenen Wertpapiere geschlagen haben, wieder herauskommen. Nur eines bleibt stets gleich: Die "Finanzexperten" kassieren lukrative Provisionen, unabhängig davon was sie jeweils anpreisen. Anders ausgedrückt: Anleger verhalten sich häufig wie dumme Schafe, die von einer Weide zur anderen getrieben werden. Die Wolle (= den Profit) stecken freilich andere ein. 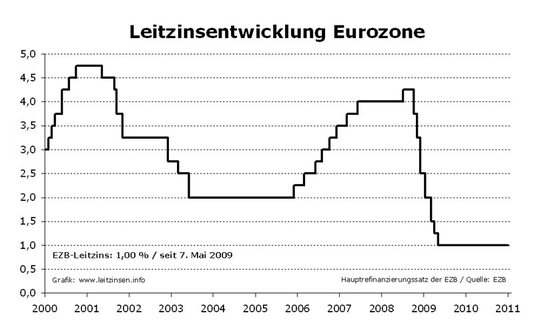
EZB-Leitzinsentwicklung 2000-2011
[Quelle: www.leitzinsen.info] 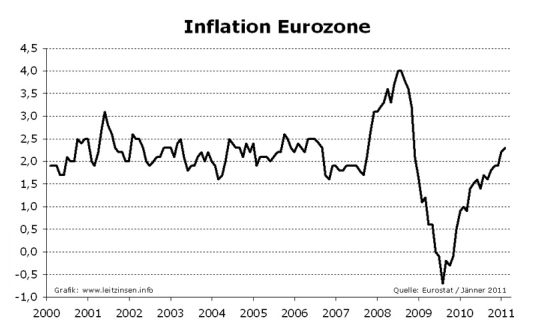 Inflationsentwicklung in der Eurozone 2000-2011 [Quelle: www.leitzinsen.info] Führt die Ausweitung der Geldmenge unvermeidbar zu einer ungesunden inflationären Entwicklung? An dieser These gibt es berechtigte Zweifel: So versuchte etwa Japan seit Anfang der neunziger Jahre mit einer enormen Ausweitung der Geldmenge und einer Niedrigzinspolitik nahe der Nulllinie die Deflation zu bekämpfen. Weitgehend erfolglos, wie wir wissen, die - in diesem Fall durchaus gewollte - Inflation wollte sich einfach nicht einstellen. Auch in den USA ist der dramatische Anstieg der Geldmenge bislang ohne Auswirkung auf die Inflationsrate geblieben. Demgegenüber ist die Geldmengenentwicklung in der Euro-Zone moderat: "Ein unerwartet geringer Anstieg der für die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank EZB wichtigen Geldmenge M3 dämpft die Angst vor einem deutlicheren Anziehen der Teuerung in der Euro-Zone. Im Januar wuchs die Geldmenge geringer als im Vormonat: das Plus lag bei 1,5 Prozent - nach Zuwächsen von 1,7 Prozent im Dezember und 2,1 Prozent im November." [3] Im Übrigen komme es gar nicht auf die stattliche Liquidität der Geschäftsbanken an, für die Inflationsentwicklung sei vielmehr das Ausmaß der vergebenen Kredite an Unternehmen und Verbraucher ausschlaggebend. Wie die Daten der Deutschen Bundesbank belegen, liegen hierzulande die Kredite an inländische Unternehmen und Privatpersonen seit drei Jahren auf dem gleichen Niveau. Es gibt folglich in Deutschland weder eine Kreditklemme noch eine Kreditschwemme. In den weniger prosperierenden Ländern der Euro-Zone ist die Entwicklung ähnlich. "Die Kreditvergabe in der Euro-Zone bleibt schwach", meldet die Frankfurter Rundschau. [4] Trichets Inflationsgespenst scheint sich in Luft aufzulösen. Was soll dann die Leitzinserhöhung überhaupt? Angeblich geht es Trichet gar nicht um die Geldmenge, sondern um die sogenannten Zweitrundeneffekte. "Zweitrundeneffekte treten auf, wenn Arbeitgeber und Gewerkschaften auf die gestiegene Inflation reagieren und deswegen höhere Löhne vereinbaren. Dabei besteht die Gefahr, dass die Unternehmen ihre gestiegenen Kosten wieder über die Preise weitergeben und sich die Inflation so nach und nach hochschaukelt. Man spricht hier von einer Lohn-Preis-Spirale." [5] Die Kerninflationsrate, also die Teuerung ohne die extern induzierten Energie- und Lebensmittelkosten, liegt indes konstant bei rund einem Prozent. Angesichts der grassierenden Arbeitslosigkeit ist im Euro-Raum kaum mit unverhältnismäßigen Lohnabschlüssen zu rechnen. In Deutschland wären dagegen höhere Löhne angesichts der Exporterfolge sogar wünschenswert, aber auch hier ist die Entwicklung der Realeinkommen bescheiden. Guten Lohnabschlüssen der Stammbelegschaften steht die Ausweitung der prekären Arbeitsverhältnisse gegenüber. Letztere mindern bekanntlich das Lohnniveau. Gegen was kämpft also der EZB-Chef? Es ist ein Rätsel. Jean-Claude Trichet hat zur Unzeit die Zinswende angekündigt, es gibt dafür zur Zeit keinen vernünftigen Grund. Ist er von allen guten Geistern verlassen? Die Gefahren, die höhere Zinsen heraufbeschwören, sind jedenfalls ungleich größer. Von daher sollte die EZB vorerst auf eine Erhöhung des Leitzinses verzichten. ---------- [1] Der Standard vom 01.03.2011 [2] Die Presse.com vom 03.03.2011 [3] n-tv vom 25.02.2011 [4] Frankfurter Rundschau vom 03.03.2011 [5] Wikipedia, Zweitrundeneffekt |
