
| Home
| Archiv
| Impressum 19. Juli 2011, von Michael Schöfer Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten Die Politik muss schleunigst ihren Kurs korrigieren. Die aktuellen Probleme der Eurozone resultieren u.a. aus dem Wegfall der Wechselkursanpassungen, mit denen Länder wie Griechenland in der Vergangenheit auf die mangelnde Konkurrenzfähigkeit ihrer Wirtschaft reagieren konnten. In der Zeit vor dem Euro hätte man die Drachme kurzerhand abgewertet, dieses Mittel steht der Athener Regierung, seit es die Gemeinschaftswährung gibt, aber gar nicht mehr zur Verfügung. Die aktuelle Misere ist daher nicht allein von den südeuropäischen EU-Mitgliedstaaten verursacht worden, eine wesentliche Ursache ist vielmehr die konsequente Niedriglohnpolitik Deutschlands, die - neben der unbestreitbaren Qualität der Waren - "Made in Germany" im Ausland so begehrt macht. Dass eine Politik, die auf riesige Außenhandelsüberschüsse setzt, bei den Handelspartnern negative Folgen hat, sollte eigentlich einleuchten. Die Überschüsse des einen sind logischerweise die Defizite des anderen. Und niemand kann sich ständig Defizite erlauben. Die hiesige Niedriglohnpolitik muss deshalb beendet werden, schon im Interesse der deutschen Arbeitnehmer selbst, denn der Aufschwung geht an ihnen überwiegend vorbei. Daten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) belegen, dass die Realeinkommen in den letzten 10 Jahren kontinuierlich gesunken sind, bei den Nettolöhnen zwischen 2000 und 2010 im Durchschnitt um 2,5 Prozent. In den unteren Einkommensgruppen sanken sie sogar um 16 bis 22 Prozent, während sie in der höchsten Einkommensgruppe um knapp ein Prozent gestiegen sind. "'Die Wirtschaft ist seit der Jahrtausendwende ordentlich gewachsen. Die Gewinne und Vermögenseinkommen sind insgesamt sogar kräftig gestiegen. Doch bei den meisten Erwerbstätigen ist von dem Wirtschaftswachstum nichts angekommen', bilanziert der DIW-Verteilungsforscher Markus Grabka die Entwicklung." [1] 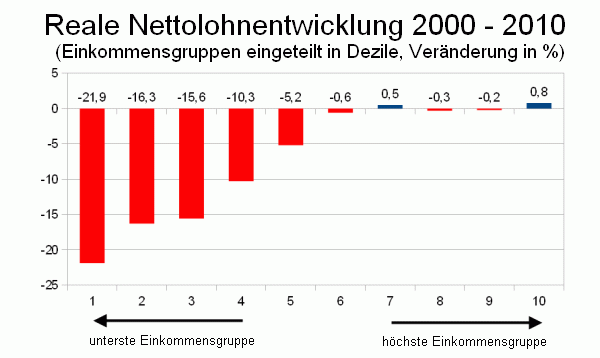 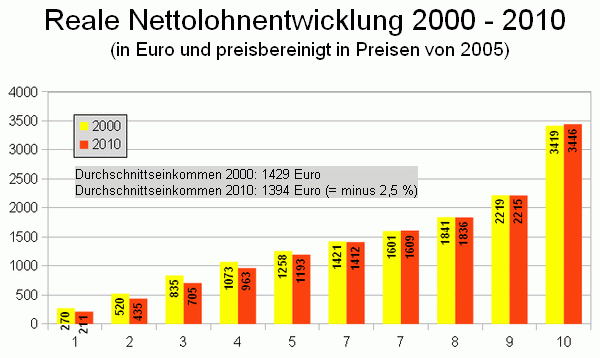 "Die rot-grüne Bundesregierung hat im Zuge der Hartz-Reformen den Druck auf Arbeitslose erhöht, irgendeinen Job anzunehmen, und sei er noch so schlecht bezahlt. Zudem wurden Leiharbeit erleichtert und Minijobs gefördert", beklagt die Frankfurter Rundschau. [2] Der Boom auf dem Arbeitsmarkt (laut Wirtschaftsminister Rainer Brüderle der "XXL-Aufschwung") findet vor allem bei den Minijobbern, Teilzeitbeschäftigten und Mitarbeitern mit befristeten Jobs statt. Mittlerweile haben 7,84 Millionen einen atypischen Arbeitsplatz (= 25,4 Prozent der abhängig Beschäftigten). Am stärksten angestiegen sind jedoch die Zeitarbeiter, diese trugen satte 57 Prozent zum Beschäftigungswachstum 2010 bei. [3] Zusätzliche reguläre Jobs (unbefristet und in Vollzeit) sind also nach wie vor rar. Keine wirklich neue Erkenntnis, aber es ist offenbar schwer, den fatalen Trend bei den Löhnen zu stoppen. Der Wirtschaftsweise Peter Bofinger empfiehlt, die Arbeitnehmer bei den Sozialabgaben zu entlasten. Beispiel Krankenversicherung: "Derzeit zahlen Beschäftigte 8,2 Prozent ihres Einkommens in die Kassen, Unternehmen nur 7,3 Prozent. Künftig sollten Arbeitnehmer und Arbeitgeber wieder jeweils die Hälfte der Kosten übernehmen", fordert Bofinger. [4] Hilfreich wäre sicherlich auch ein gesetzlicher Mindestlohn, der die Einkommen nach unten absichert, so dass sie nicht ins Bodenlose fallen können. 2008 arbeiteten immerhin 1,15 Mio. Arbeitnehmer für einen Stundenlohn von unter 5 Euro, 2,11 Mio. für einen unter 6 Euro und 3,7 Mio. für einen unter 7 Euro. [5] Der von manchen favorisierte Branchenmindestlohn, der laut Gesetzgeber nur dort vereinbart werden kann, wo überhaupt ein Tarifvertrag existiert, ist als Schutz gegen Niedriglöhne absolut unzureichend. 2009 arbeiteten in Westdeutschland 35 Prozent der Arbeitnehmer in Betrieben ohne Tarifbindung, in Ostdeutschland waren es 49 Prozent. [6] Ihnen kann folglich nur der gesetzliche Mindestlohn helfen, ein Branchenmindestlohn ist hier vollkommen wirkungslos. Für Schwarz-Gelb ist der gesetzliche Mindestlohn allerdings ein rotes Tuch, die gegenwärtige Bundesregierung wird ihn daher wohl kaum einführen. Die Gewerkschaften wiederum sollten künftig den Verteilungsspielraum stärker ausschöpfen. Dazu ist freilich die Unterstützung durch die Beschäftigten notwendig, bedauerlicherweise hat es genau daran in bestimmten Bereichen gemangelt. Gewerkschaften leben von der aktiven Beteiligung ihrer Mitglieder und von der Streikbereitschaft der Belegschaften. Die Haltung, sich das Ganze vom Sofa aus anzusehen und insgeheim zu hoffen, es werde schon irgendjemand für einen auf die Straße gehen, dürfte nicht allzu weit führen. Die Beschäftigten müssen es schon selbst tun. Wie stark derartige Appelle fruchten, werden die nächsten Tarifverhandlungen zeigen. ---------- [1] Berliner Zeitung vom 19.07.2011 [2] Frankfurter Rundschau vom 19.07.2011 [3] Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 270 vom 19.07.2011 [4] Frankfurter Rundschau a.a.O. [5] Institut Arbeit und Qualifikation, Universität Duisburg-Essen, IAQ-Report 2010-06, PDF-Datei mit 422 kb [6] Wikipedia, Mindestlohn, Situation in ausgewählten Staaten |
