
| Home
| Archiv
| Impressum 02. März 2014, von Michael Schöfer Eine europäische Neuauflage von "The Great Game"? Wie am 28. Februar vorhergesagt [1], schaukelt sich der Konflikt um die Ukraine immer weiter hoch. Nationalistische Gefühle drohen auf beiden Seiten die Vernunft zurückzudrängen. Wladimir Putin hat sich vom russischen Föderationsrat die Zustimmung für einen Militäreinsatz auf der Krim geben lassen. [2] Auf der anderen Seite fordert der in Westeuropa hochgelobte Präsidentschaftskandidat Vitali Klitschko die "Generalmobilmachung" der ukrainischen Armee. [3] Wer derart schnell nach der Generalmobilmachung ruft, gehört offenbar nicht zu den besonnenen Kräften, aber genau die werden jetzt am dringendsten gebraucht. Schließlich schreiben wir heuer nicht 1914. Vielleicht hatte die US-Europabeauftragte Victoria Nuland ("Fuck the EU") doch recht, als sie sich in ihrem mitgeschnittenen Telefongespräch abwertend über Klitschko geäußert hat ("Ich glaube nicht, dass Klitsch [Klitschko] in der Regierung sein sollte"). [4] Es heißt zwar, die Genehmigung für den Militäreinsatz auf der Krim sei nicht gleichbedeutend mit dem Beginn desselben, dennoch hat der Westen Wladimir Putin möglicherweise falsch eingeschätzt. Auf der Krim könnte sich ihm die Gelegenheit bieten, gegenüber der Nato endlich einmal die Krallen auszufahren. Es geht hier allerdings nicht bloß um Putins persönliche Interessen, sondern um die ganz Russlands. Dass die Nato immer näher an Russland heranrückt, erfüllt dort viele Menschen mit Sorge. Wenn Putin nach dem Motto "bis hierher und nicht weiter" handelt, darf er sich des Zuspruchs seiner Landsleute sicher sein. Wie in praktisch allen Konflikten gibt man die Schuld an der Eskalation stets nur der anderen Seite. In der Frankfurter Rundschau wird beispielsweise an das "Budapester Memorandum" aus dem Jahr 1994 erinnert. Darin verpflichteten sich die USA, Großbritannien und Russland die Unabhängigkeit, Souveränität und die bestehenden Grenzen der Ukraine zu respektieren. Pacta sunt servanda, soll das wohl mit mahnendem Blick auf Putin heißen, Verträge sind einzuhalten. Doch das ist bloß eine Seite der Medaille, die andere heißt "Nato-Osterweiterung". Der hierzulande immer noch beliebte frühere sowjetische Außenminister Eduard Schewardnadse sagte 2009 in einem Interview mit dem Spiegel Folgendes: "SPIEGEL ONLINE: Im Februar 1990 versicherte Ihnen Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher, die Nato 'werde sich nicht nach Osten ausdehnen'. Das beziehe sich nicht nur auf die DDR; sondern 'gelte ganz generell'. Laut Protokoll sollen Sie gesagt haben, 'man glaube allen Worten des BM'. Warum haben Sie sich das nicht schriftlich geben lassen? Schewardnadse: Die Zeiten ändern sich. Damals konnten wir uns nicht vorstellen, dass sich der Warschauer Pakt auflösen würde. Das lag außerhalb unserer Vorstellungswelt. Keines der Mitgliedsländer stellte damals den Warschauer Pakt in Zweifel. Und die heutigen drei baltischen Republiken, die jetzt Mitglied der Nato sind, waren damals noch Teil der Sowjetunion. Wir gaben schließlich unsere Zustimmung dazu, dass das vereinigte Deutschland der Nato angehören durfte, unter bestimmten Auflagen. So wurde etwa die Stärke der Bundeswehr auf 370.000 Mann begrenzt, Deutschland verzichtete auf Atomwaffen. Eine Ausdehnung der Nato über die Grenzen Deutschlands hinaus war überhaupt kein Thema." [5] Und der jeglicher Missgunst gegenüber dem Westen vollkommen unverdächtige Michail Gorbatschow klagte im gleichen Jahr in der Bild-Zeitung: "Kohl, US-Außenminister James Baker und andere sicherten mir zu, dass die Nato sich keinen Zentimeter nach Osten bewegen würde. Daran haben sich die Amerikaner nicht gehalten, und den Deutschen war es gleichgültig. Vielleicht haben sie sich sogar die Hände gerieben, wie toll man die Russen über den Tisch gezogen hat. Was hat es gebracht? Nur, dass die Russen westlichen Versprechungen nun nicht mehr trauen." [6] Gilt das Prinzip "Pacta sunt servanda" lediglich für die russische Seite? Oder sollte sich auch der Westen an seine Versprechen halten, selbst wenn diese in der Phase des kommunistischen Zusammenbruchs nicht schriftlich fixiert wurden? 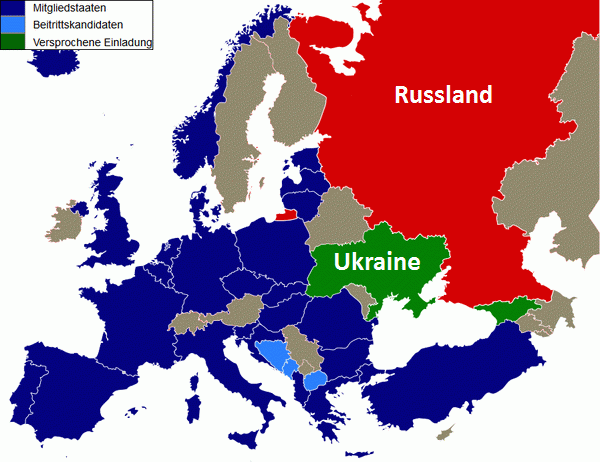 Die Osterweiterung der Nato [Quelle: Wikipedia, Urheber: Patrickneil, Bild ist public domain, farbliche Änderungen und Beschriftung durch den Autor] Fehleinschätzungen der Motive des anderen sind - neben Gier und Hass - eine weitverbreitete Ursache von bewaffneten Konflikten. Und der Westen hat, trotz mehrfach öffentlich geäußertem Unmut der russischen Seite, die vorhandenen Vorbehalte Russlands beharrlich ignoriert. Wir hätten gewarnt sein müssen: Schon 1996 hat der damalige russische Präsident Boris Jelzin gegenüber dem deutschen Außenminister Klaus Kinkel die Nato-Osterweiterung kategorisch abgelehnt. Reaktion der deutschen Presse: "Die neuerliche klare Absage an den Ostkurs der NATO kam ein halbes Jahr vor den Präsidentschaftswahlen (...) nicht unerwartet. Um da wenigstens einen Blumentopf gewinnen zu können, muß Jelzin gegenüber dem Westen die Großmacht herauskehren." [7] Anders ausgedrückt: "Nicht ernst zu nehmen, das muss er halt sagen." Jelzin hat aber sein Nein zur Nato-Osterweiterung auch nach den russischen Präsidentschaftswahlen bekräftigt, es war also nicht bloß Wahlkampfrhetorik. [8] Eine Position, die Putin übrigens ebenfalls von Anfang an vertreten hat. Warum fällt es uns eigentlich so schwer zu begreifen, dass das Vordringen der Nato bis an die Grenzen Russlands dort als Bedrohung empfunden wird? "59 Prozent der Russen glauben, dass die Nato-Osterweiterung eine Gefahr für Russlands Sicherheit darstellt. Das ergab eine Umfrage des russischen Meinungsforschungszentrums WZIOM." [9] Umgekehrt fällt es ja den Russen ebenso schwer zu realisieren, dass sich die ehemaligen Vasallen der Sowjetunion vom russischen Riesenreich sogar heute noch bedroht fühlen. Es geht, wie bereits erwähnt, bei Konflikten nicht darum, was objektiv richtig ist (soweit sich das überhaupt feststellen lässt), sondern um das, was die Beteiligten voneinander glauben. Oder handelt hier der Westen tatsächlich bewusst zum Nachteil Russlands? In diesem Fall wäre die Ukraine bloß eine Figur auf dem strategischen Schachbrett, das Ganze also gewissermaßen eine europäische Neuauflage von "The Great Game", dem Machtkampf um die Vorherrschaft. Das kann freilich böse ins Auge gehen. Heute greifen wir uns an den Kopf, wenn wir uns die Konstellation am Vorabend des I. Weltkrieges zu Gemüte führen. Wie konnten die Staaten nur so dumm sein und schnurstracks in den Krieg rennen? Doch handeln wir heute, exakt 100 Jahre nach Kriegsausbruch, wirklich schlauer? Die Zweifel daran wachsen, wir könnten uns nämlich unversehens in einem größeren Flächenbrand wiederfinden. Einem Flächenbrand, von dem es später heißen wird, so habe das niemand gewollt. Ähnlich wie anno 1914. ---------- [1] siehe Was hat die Nato da geritten? vom 28.02.2014 [2] Ria Novosti vom 01.03.2014 [3] tagesschau.de vom 01.03.2014 [4] Der unbekannte Gesichtspunkt vom 08.02.2014 [5] Spiegel-Online vom 25.11.2009 [6] Bild vom 02.04.2009 [7] Berliner Zeitung vom 29.01.1996 [8] Der Tagesspiegel vom 22.03.1997 [9] Ria Novosti vom 29.11.2011 |
