
| Home
| Archiv
| Impressum 18. Mai 2013, von Michael Schöfer Die Mehrheit ist von den Steuerplänen der Grünen nicht betroffen Umfragen sind immer wieder aufs Neue amüsant, weil sie zu kuriosen Ergebnissen führen. Nehmen wir etwa das aktuelle ZDF-Politbarometer: Bundeskanzlerin Angela Merkel ist hierzulande nicht nur mit großem Abstand die beliebteste Politikerin (mit +2,4 deutlich vor Wolfgang Schäuble mit +1,5), sondern liegt auch bei der Frage "Wen hätten Sie lieber als Bundeskanzler/in?" mit 62 Prozent klar vor Peer Steinbrück, der nur auf 29 Prozent kommt. Andererseits glauben lediglich 21 Prozent, dass die Regierung bei der Lösung der anstehenden Probleme vorankomme, während satte 74 Prozent vom Gegenteil überzeugt sind. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Die Regierungspolitik wird zwar von fast drei Viertel der Befragten negativ bewertet, aber gleichzeitig sind die Regierungschefin und ihr Finanzminister die beliebtesten Politiker Deutschlands. 47 Prozent wünschen sich weiterhin eine von CDU/CSU geführte Bundesregierung, allerdings bloß 43 Prozent eine SPD-geführte. [1] Widersprüchlicher geht es kaum. Diese Werte sind weder für die Regierung noch für die Opposition schmeichelhaft. Das gleiche Phänomen begegnet uns bei der Steuerpolitik. Die Grünen sind laut Umfrage neuerdings auf 13 Prozent gesunken (minus 1%). Von interessierter Seite wird das mit den jüngst beschlossenen Steuerplänen begründet, die angeblich auf breite Ablehnung stoßen würden. 53 Prozent der Politbarometer-Befragten glauben, dass dieser Passus im Wahlprogramm den Grünen schadet. Warum eigentlich? Ab einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 62.000 Euro würde die Belastung durch die Steuerpläne der Grünen ansteigen, beklagt die konservative FAZ. "Bei zwölf Gehältern im Jahr wären Monatseinkommen von knapp 5200 Euro betroffen, bei 13 Monatsgehältern sogar schon ab rund 4770 Euro." [2] Zum Vergleich mit der eigenen Gehaltsmitteilung: 62.000 Euro sind bei 12 Gehältern in der Steuerklasse I (ohne Kinderfreibetrag, mit Kirchensteuer) monatlich netto 2.880 Euro [3], dem steht eine Mehrbelastung von gerade mal 1,08 Euro gegenüber. Bei einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 70.000 Euro (netto pro Monat 3.174 Euro) müsste man laut FAZ monatlich 30,58 Euro mehr zahlen als vorher. Bei einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 80.000 Euro (netto pro Monat 3.610 Euro) wären es 83,33 Euro. Zweifellos schockierende Zahlen. (Achtung: Ironie!) Ist das tatsächlich eine "Kampfansage an die Mittelschicht", wie der "Bund der Steuerzahler" meint? [4] Mit Verlaub, dieser Einwand ist dummes Zeug, denn wer verdient überhaupt mehr als 62.000 Euro? Wie viele wären von den geplanten Steuererhöhungen konkret betroffen? Darüber schweigen sich die Kritiker bedauerlicherweise aus. Die Daten zur Schichtung bei den Bruttoeinkommen sind leider veraltet. "Aufgrund der langen Veranlagungsdauer (2 ¾ Jahre nach Ende des Veranlagungsjahres), der schwierigen Aufbereitung und der großen Datenmenge können vollständige Ergebnisse eines Veranlagungsjahres erst 3 ½ Jahre nach Ende des Veranlagungszeitraums vorliegen", teilt dazu das Statistische Bundesamt mit. [5] Wenigstens findet man in der Einkommensteuerstatistik Daten zur Schichtung aus dem Jahr 2008. [6] Danach verteilen sich die Steuerpflichtigen auf die Einkommensklassen wie folgt:
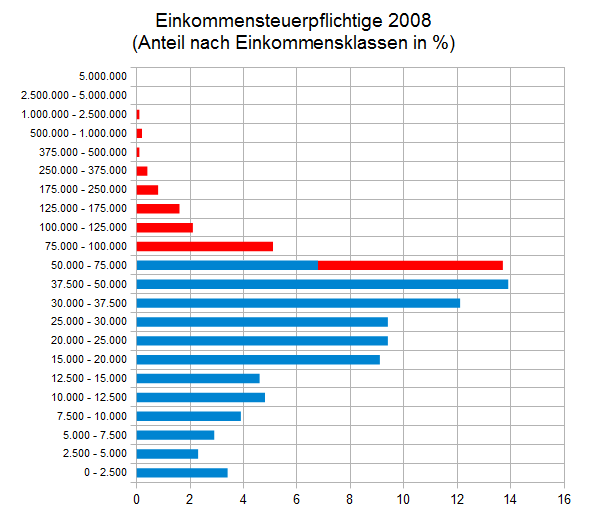 rot = wären durch die Steuerpläne der Grünen
belastet,
blau = wären durch die Steuerpläne der Grünen entlastet Ergebnis: Mindestens 75,8 Prozent der Steuerpflichtigen (mit Einkünften von 0 bis 50.000 €) wären damals von den Steuerplänen der Grünen nicht negativ tangiert gewesen (blaue Balken in der o.a. Grafik). Im Gegenteil, sie hätten eine steuerliche Entlastung erfahren. In der Einkommensklasse von 50.000 bis 75.000 lässt sich der Wert unter und über 62.000 Euro leider nicht ermitteln, weshalb ich der Einfachheit halber eine hälftige Verteilung unterstellt habe. Zu den 75,8 Prozent kommen also noch einmal 6,8 Prozent hinzu. Damit wären 2008 knapp 83 Prozent der Steuerpflichtigen von zusätzlichen Belastungen aufgrund der grünen Steuerpläne befreit gewesen. Gut 17 Prozent (= die Besserverdienenden) hätten mehr zahlen müssen. Angesichts der in den vergangenen Jahrzehnten gewachsenen Ungleichheit ein durchaus erwünschter Effekt. Wahrscheinlich hat sich die Schichtung der Einkommen seitdem nicht dramatisch verändert. Laut aktuellem ZDF-Politbarometer sagen 19 Prozent der Befragten, dass sich ihre steuerliche Belastung durch die grünen Steuerpläne erhöhen würde. Meine Einschätzung ist demnach plausibel. Die große Mehrheit ist somit von den grünen Steuerplänen gar nicht betroffen, daher sind diese auch keine "Kampfansage an die Mittelschicht". Das, was der "Bund der Steuerzahler" darüber verbreitet, wird - wie man unschwer erkennen kann - von der Presse überwiegend kritiklos übernommen. Die veröffentlichte Meinung spiegelt jedoch den wahren Sachverhalt nicht wider, Proteste gegen die grünen Steuerpläne sind vollkommen fehl am Platze. Außerdem sollte man sich einmal damit auseinandersetzen, was sich eigentlich hinter dem "Bund der Steuerzahler" und dem ihm zuarbeitenden "Karl-Bräuer-Institut" verbirgt. Schon allein der Name lässt aufhorchen: Der 1881 geborene Karl Bräuer war laut Wikipedia "Mitglied der NSDAP (Nr. 3.436.154), Untersturmführer der SS (Nr. 124.599) sowie von 1935-1945 Schulungsleiter für Rasse- und Siedlungsfragen". 1946 wurde Bräuer "im Zuge der Entnazifizierung emeritiert und aus allen Ämtern entlassen. Nach dem Aufenthalt in verschiedenen Internierungslagern begründete Karl Bräuer 1949 gemeinsam mit anderen den Bund der Steuerzahler." [7] "Der BdSt gibt an, dass seine Mitglieder zu 60 bis 70 Prozent aus Unternehmen des gewerblichen Mittelstands bestünden, die übrigen Mitglieder seien in ihrer Mehrheit Privatpersonen." [8] Unter Letzteren sollen sich viele Freiberufler und leitende Angestellte befinden. [9] Mit anderen Worten: Durchschnittsarbeitnehmer sind dort eher selten anzutreffen. Es verwundert kaum, dass sich eine Organisation mit dieser Mitgliederstruktur vehement gegen Steuererhöhungen einsetzt und dabei deren Auswirkungen in den dunkelsten Farben an die Wand malt. In die gleiche Kerbe hauen der "Zentralverband des Deutschen Handwerks" und die vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall gegründete "Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft". Die Polemik gegen die grünen Steuerpläne ist mithin eindeutig interessengeleitet. Doch das sind Interessen, die mit denen der Arbeitnehmer und der Mittelschicht schwerlich übereinstimmen. Diejenigen, die sich nun gewissermaßen als Lordsiegelbewahrer der Arbeitnehmer und der Mittelschicht gerieren, haben in der Vergangenheit stets weiteren Sozialabbau gepredigt, etwa mit der ausdrücklichen Unterstützung der "Agenda 2010". Genau das hat uns aber das dramatische Schrumpfen der Mittelschicht [10] und die fatale Ausweitung des Niedriglohnsektors [11] beschert, während gleichzeitig die Zahl der Millionäre auf 951.200 [12] gestiegen ist. Man sollte eben gründlich eruieren, wem man vertraut. ---------- [1] ZDF, Politbarometer vom 17.05.2013 [2] FAZ.Net vom 03.05.2013 [3] Süddeutsche Zeitung, Gehaltsrechner [4] Bund der Steuerzahler, Pressemitteilung vom 28.04.2013 [5] Statistisches Bundesamt, Kurzfassung des Qualitätsberichts Jährliche Einkommensteuerstatistik, 13. September 2012, Seite 5, PDF-Datei mit 123 kb [6] Statistisches Bundesamt, Jährliche Einkommensteuerstatistik, Fachserie 14 Reihe 7.1.1 - 2008, PDF-Datei mit 961 kb, Seite 8 [7] Wikipedia, Karl Bräuer [8] Wikipedia, Bund der Steuerzahler (Deutschland) [9] Hans Böckler Stiftung, Arbeitspapier 161, Rudolf Speth, Für wen spricht der Steuerzahlerbund?, Seite 21, PDF-Datei mit 576 kb [10] Spiegel-Online vom 13.12.2012 [11] RP-Online vom 10.09.2012 [12] Spiegel-Online vom 19.06.2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
