
| Home | Archiv
| Impressum 11. Januar 2014, von Michael Schöfer Eingreifen oder heraushalten? Mit der Begründung des damaligen Außenministers Joschka Fischer, "Ich habe nicht nur gelernt: Nie wieder Krieg. Ich habe auch gelernt: Nie wieder Auschwitz", leitete die Regierung Gerhard Schröder 1999 mit dem Kosovokrieg das Zeitalter des bundesdeutschen Interventionismus ein. Ausgerechnet Rot-Grün. Seitdem sind, die verständliche Abstinenz nach dem II. Weltkrieg hinter sich lassend, auch wieder Kampfeinsätze der Bundeswehr möglich. Natürlich brauchte man für die Enttabuisierung eine ethische Begründung, und was wäre da besser geeignet gewesen als die Moralkeule Auschwitz? Nichts. Nun gilt: Immer wenn irgendwo auf der Welt Menschen vertrieben und/oder ermordet werden, stellen wir uns die Frage: Eingreifen oder heraushalten? Wen lässt schon das grausame Schicksal verstümmelter Opfer oder massenhaft vergewaltigter Frauen kalt? Keinen. Dennoch ist die Frage gar nicht so leicht zu beantworten. Sarah Brockmeier vom Global Public Policy Institute (GPPi), einer unabhängigen Denkfabrik mit Sitz in Berlin, ist der Ansicht, wir müssten deutsche Soldaten in den Südsudan entsenden - ein Land, das durch den gerade beginnenden Bürgerkrieg zu zerreißen droht. "Im Südsudan sind Tausende Menschen in akuter Lebensgefahr. Die Deutschen schicken Lebensmittel und Medikamente und empfehlen eine friedliche Lösung. Damit, so finden sie, haben sie ihren Beitrag geleistet. (…) Die Deutschen können sich entscheiden, es bei humanitärer Hilfe und ernsten Ermahnungen ihres Außenministers zu belassen. Dann müssen sie aber die Konsequenzen klar benennen, statt auf die UN, die EU oder die Afrikanische Union zu verweisen, als würden diese ihren Beitrag übernehmen. Viele Menschen, die auf schnellen Schutz angewiesen sind, werden diesen nicht bekommen. Die Bundesregierung, der Bundestag, die Zivilgesellschaft, jeder einzelne Wähler kann sich entscheiden, nicht mehr zu tun. Aber für die Menschenleben, die die Deutschen retten könnten, kann und wird kein anderer die Verantwortung übernehmen." [1] Das ist, ohne es expressis verbis zu fordern, die kaum verhüllte Aufforderung zu einem militärischen Engagement. In letzter Konsequenz, falls sich die südsudanesischen Bürgerkriegsparteien nicht doch noch verständigen, also zu einem Kampfeinsatz. Deutschland habe "ein starkes Eigeninteresse an Stabilität vor seiner Haustür", meint Brockmeier. Das ist, bei allem Wohlwollen, übertrieben. Ein Land, das 5.200 km weit weg ist, liegt ganz gewiss nicht vor unserer Haustür, schließlich leben die Südsudanesen in der Nähe des Äquators. Andererseits relativiert die Entfernung natürlich nicht die moralische Verpflichtung, bei gravierenden Menschenrechtsverletzungen helfend einzugreifen, Distanzen sind diesbezüglich nämlich vollkommen irrelevant. Allerdings ist hierbei die Existenz eines Dilemmas kaum zu leugnen: Wir können nicht überall Soldaten hinschicken. Und wir wollen es vermutlich auch nicht. Beim Genozid in Ruanda, dem innerhalb von nur wenigen Wochen mindestens 800.000 Menschen zum Opfer fielen, hätte die Weltgemeinschaft unbedingt intervenieren müssen. Dazu war er einfach viel zu monströs. 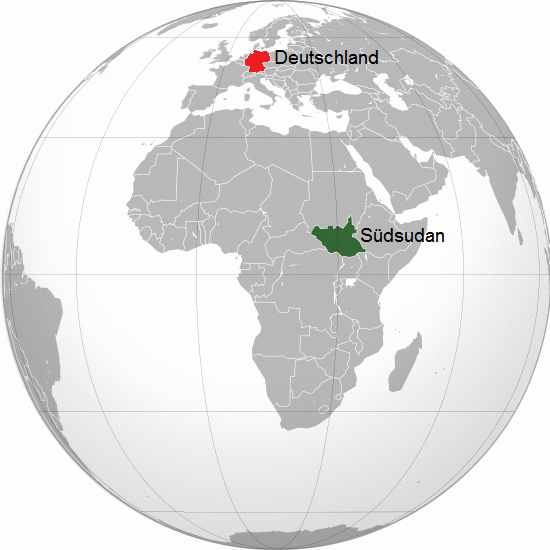 Liegt
der Südsudan wirklich vor unserer Hautür?
[Quelle: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0-Lizenz, Urheber: TUBS, derivative work: Spesh531 und durch den Autor] Nach Untersuchungen der Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung (AKUF) am Institut für Politikwissenschaft der Universität Hamburg gab es 2013 insgesamt 30 Kriege und bewaffnete Konflikte. [2] Es können aber je nach Definition durchaus noch ein paar hinzukommen, so fehlt etwa bei der AKUF der Drogenkrieg in Mexiko, der seit 2006 rund 70.000 Menschenleben kostete. Das Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung (HIIK) kam in seinem "Conflict Barometer 2012" weltweit auf 18 Kriege, 25 begrenzte Kriege und 43 hochgradig gewaltsame Konflikte. [3] 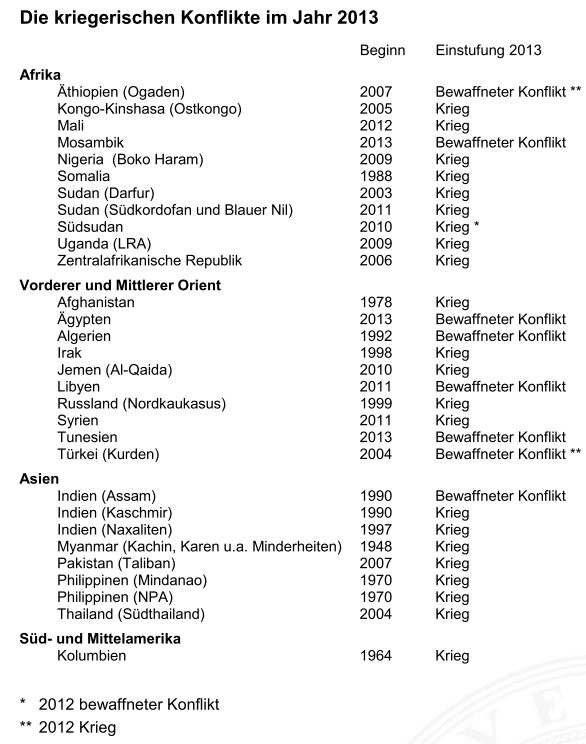 [Quelle:
AKUF, Pressemeldung vom 19.12.2013, PDF-Datei mit 122 kb]
Selbst wenn wir es wollten, die Beteiligung der Bundeswehr an sämtlichen Konflikten ist schlicht und ergreifend ein Ding der Unmöglichkeit - auch wenn die Bilder, die abends in der Tagesschau über den Bildschirm flimmern, schwer auszuhalten sind. Es ist zudem fraglich, wie viele davon sich überhaupt mit dem Einsatz von UN-Truppen beenden ließen. Um die Gewalt wirksam zu unterbinden, müssten die Vereinten Nationen ganze Staaten oder sogar Regionen bis auf weiteres militärisch besetzen. Etwas, woran die UN schon allein politisch scheitern würden und wofür ihnen obendrein gar nicht genügend Truppen zur Verfügung stehen. (Die UN haben keine eigenen Truppen, sie können nur einsetzen, was ihnen die Staatengemeinschaft bereitstellt.) Um 2003 den Irak zu besetzen, brauchte die "Koalition der Willigen" rund 300.000 Soldaten - ohne den Widerstand jemals vollständig brechen zu können. Wie groß müsste daher die Truppenstärke sein, um die ungleich größere Republik Kongo mitsamt ihren Nachbarstaaten zu befrieden? Halb Afrika ist mittlerweile Konfliktgebiet. Doch die Ausmaße des Kontinents werden häufig krass unterschätzt: In die 30.221.532 qkm Afrikas passen Russland (17.098.242 qkm), die USA (9.826.675 qkm) und Indien (3.287.469 qkm). [4] Alle gemeinsam, wohlgemerkt. 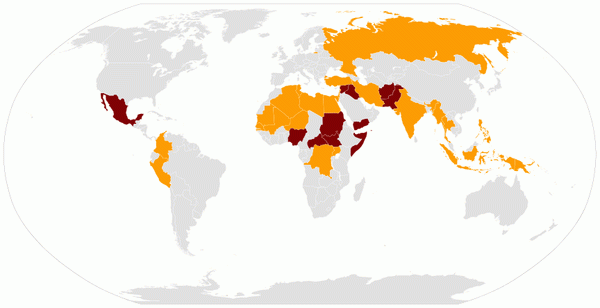 Konfliktgebiete der Erde [Quelle: Wikipedia, CC BY-SA 3.0-Lizenz, Urheber: Canuckguy, derivative work: Futuretrillionaire] Die moralische Intention Sarah Brockmeiers in allen Ehren, aber würde man bei allen Konflikten den gleichen Maßstab anlegen, müssten wir in jeden eingreifen. Deutschland könnte im Südsudan mehr tun? Vielleicht, aber was ist dann mit Mali, Syrien oder der Zentralafrikanischen Republik? Um nur drei weitere aktuelle Konflikte zu nennen, bei denen es zu Gräueltaten kommt und in denen vor allem Zivilisten die Leidtragenden sind. Dazu fehlt die Kraft, wie man unschwer erkennen kann. Alle Konflikte zu ersticken gelänge wahrscheinlich nicht einmal der stärksten Militärmacht der Welt, den Vereinigten Staaten von Amerika. Es wird folglich, selbst wenn man humanitären Interventionen wohlwollend gegenübersteht, höchstens punktuell zu Militäreinsätzen kommen. Und für diese Auswahlentscheidung fehlt bislang ein objektiver Maßstab. Außerdem ist der Begriff "humanitäre Intervention" kritisch zu hinterfragen, denn nicht überall wo "humanitär" draufsteht, ist am Ende auch "humanitär" drin. Die Deklarierung als humanitäre Intervention dient leider allzu oft bloß der Bemäntelung ganz anderer Interessen (politischer oder ökonomischer Art). Viel hilfreicher wäre m.E. die Weiterentwicklung des internationalen Rechts. Dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH ) in Den Haag sind bislang nur 122 von insgesamt 194 Staaten beigetreten (Stand: Juli 2013). So wichtige Länder wie die USA, Russland, China, Indien, Israel, Saudi-Arabien oder die Türkei blieben dem Vertragswerk bis dato fern. Dementsprechend sieht die globale Verteilung der Verfahren aus. Es wurde moniert, beim IStGH säße ausschließlich der Süden auf der Anklagebank, während der mächtige Norden straffrei ausgehe. Dritte-Welt-Autokraten, wie etwa Laurent Gbagbo aus der Elfenbeinküste, mache man den Prozess, mutmaßliche Täter aus den reichen Industriestaaten, wie zum Beispiel der frühere US-Präsident George W. Bush, hätten hingegen keine Strafe zu befürchten. Ein Argument, das genau besehen tatsächlich zutrifft. 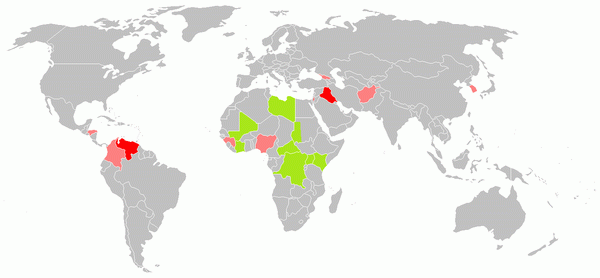 Nord-Süd-Gefälle:
Untersuchungen des IStGH
hellgrün: offizielle Untersuchungen hellrot: Vorermittlungen dunkelrot: geschlossene Vorermittlungen, Quelle: Wikipedia, CC BY-SA 3.0-Lizenz, Urheber: Snocrates, derivative work: AndrewRT] Man darf gespannt sein, wie die Anzeige der Nichtregierungsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) und der Public Interest Lawyers (PIL), einer gemeinnützigen Anwaltskanzlei aus Birmingham, gegen Großbritannien wegen systematischer Folter und Kriegsverbrechen im Irak ausgeht. Gilt wirklich gleiches Recht für alle? Oder sind einige mal wieder wie gehabt gleicher? Müsste sich jeder Täter, ungeachtet seiner Person und seiner Herkunft, vor dem IStGH verantworten, gäbe es wahrscheinlich generell weniger Konflikte. Prävention anstatt Repression. Von der Beseitigung der eigentlichen Konfliktursachen, der ungleichen Verteilung des Reichtums, ganz zu schweigen. So mancher Despot oder Rebell würde es sich bestimmt dreimal überlegen, ob er schwere Verbrechen begehen soll, wenn er dabei langjährige Haftstrafen riskiert. Grundvoraussetzung: Verbrecher müssten tatsächlich ohne Ausnahme damit rechnen, in Den Haag vor Gericht gestellt zu werden. Militäraktionen mögen kurzfristig helfen, langfristig lösen sie keine Probleme. Kaum erstickt man einen Konflikt, bricht andernorts schon ein neuer aus. Deshalb stehen wir immer wieder vor dem moralischen Dilemma: Eingreifen oder heraushalten? ---------- [1] GPPi, veröffentlicht in der Süddeutschen vom 09.01.2014 [2] AKUF, Pressemeldung vom 19.12.2013, PDF-Datei mit 122 kb [3] HIIK, PDF-Datei mit 6,6 MB [4] Lexas, Flächendaten aller Staaten |
