
| Home | Archiv
| Impressum 14. September 2014, von Michael Schöfer Rückfall in die Kleinstaaterei Unruhige Zeiten: Staaten zerfallen, Kriege und Bürgerkriege wüten, Terrorgruppen bringen ganze Regionen unter ihre Kontrolle. Wohin wird das führen? Es droht der Rückfall in längst überwunden geglaubte Zeiten. So ist etwa der Vergleich der Geschehnisse im heutigen Nahen Osten mit dem Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) keineswegs an den Haaren herbeigezogen. Vielleicht dauert der absolut unübersichtliche, extrem brutale Konflikt sogar noch länger. Das kann derzeit niemand genau vorhersagen. Aber es gibt sie - Inseln der relativen Ruhe, wie etwa Westeuropa. Momentan zwar von einer schweren Finanz- und Wirtschaftskrise gebeutelt, aber politisch dennoch recht stabil. Bislang jedenfalls. Doch auch hier sind Auflösungserscheinungen nicht zu übersehen. Während um Europa herum reihenweise sogenannte "failed states" (gescheiterte Staaten) entstehen, in denen sich diverse Bevölkerungsgruppen gegenseitig abschlachten, leisten sich die Europäer den Luxus des Separatismus. Und wir reden hier einmal zur Abwechslung nicht über die Ukraine. Sie wollen alle, zum Teil schon seit Jahrzehnten, unabhängig werden: die Korsen, die Basken, die Katalanen, die Schotten, die Norditaliener, die Flamen... Habe ich eine nach Unabhängigkeit strebende Volksgruppe übersehen? Sorry, keine Absicht! Kürzlich hat Claude Michael Jung in einer lesenswerten Glosse scherzhaft die Unabhängigkeit des Saarlandes gefordert. [1] Und wenn ich ehrlich bin, habe ich ebenfalls schon gelegentlich an die Gründung der "Pfälzischen Befreiungsfront" gedacht. Natürlich genauso wenig ernstgemeint. Motto: Weg vom Rheinland! Wir Pfälzer würden natürlich das ökonomisch marode Saarland trotz der fest eingebrannten Aversion zwischen unseren Volksgruppen völlig uneigennützig mithilfe weißer Lastwagenkolonnen unterstützen. Nach gründlicher Grenzkontrolle und selbstverständlich nur im Einvernehmen mit der saarländischen Staatsregierung, versteht sich. Da ich in Mannheim wohne und arbeite, muss die alte Residenzstadt der Kurpfalz (1720-1778) zwangsläufig zu einem Brückenkopf der Pfälzischen Befreiungsfront werden. Notfalls durch den Einsatz von "höflichen grünen Männchen". Was die Badenser dazu sagen, die sich ihrerseits von den Gelbfüßlern (den Schwaben) separieren, ist mir vollkommen gleichgültig. Liebe Leserinnen und Leser, Sie sehen, künftige Konflikte sind bereits vorprogrammiert. Nicht lachen, denn solche Bestrebungen gab es tatsächlich schon einmal. 1918 gründete der Chemiker Eberhard Haaß in Landau den "Bund Freie Pfalz" und rief im Jahr darauf sogar die "Pfälzische Republik" aus. Die Pfalz gehörte damals zu Bayern. Der Versuch scheiterte allerdings. In den Wirren der Nachkriegszeit unternahm Johannes Hoffmann 1923 den zweiten Anlauf zu einem selbständigen pfälzischen Staat. Doch auch dieser Versuch scheiterte kläglich. Dritter Anlauf: Das "Pfälzische Corps" unter Franz Josef Heinz eroberte im gleichen Jahr die Städte Kaiserslautern, Neustadt an der Haardt und Landau. Er rief die "Autonome Pfalz im Verband der Rheinischen Republik" aus, doch die Separatistenführer wurden kurz danach von Rechtsradikalen ermordet. [2] Hätten spätere politische Entwicklungen daran nichts mehr geändert, würden die Pfälzer heute CSU wählen und Horst Seehofer wäre ihr Landesvater. Apropos CSU: Das CSU-Vorstandsmitglied Wilfried Scharnagl, ein alter Spezi von Franz Josef Strauß und ehedem Chefredakteur des Bayernkuriers ("Scharnagl schreibt, was ich denke, und ich denke, was Scharnagl schreibt"), forderte 2012 ernsthaft die Abspaltung Bayerns von der Bundesrepublik Deutschland. Motto: "Bayern kann es auch allein." Der 21. Januar 1871, als das bayerische Parlament dem Beitritt zum Deutschen Reich zustimmte, sei ein "Tag des Unheils für Bayern" gewesen. "'Die geschichtlichen Erfahrungen Bayerns zeigen, dass das große und wichtige Land im deutschen Süden stets dafür büßen musste, wenn es einer fernen Zentralgewalt ausgeliefert war', schreibt Scharnagl. Und heute sei der Freistaat gleich zwei 'Zentralgewalten' ausgeliefert - Berlin und Brüssel." [3] Wer weiß, auf welche Ideen die Bayern kommen, sollte die PKW-Maut an Berlin oder Brüssel scheitern. Die Schotten stimmen am 18. September 2014 in einer Volksabstimmung über ihre Unabhängigkeit ab. Das Ergebnis wird, zumindest den bisherigen Umfragen zufolge, ziemlich knapp ausfallen. Falls die Schotten wirklich für die Loslösung von Großbritannien votieren, muss sich das verbleibende "Kleinbritannien" notgedrungen eine neue Flagge suchen. Der Union Jack ist dann definitiv obsolet. Und "Rule, Britannia" endgültig perdu. Aber vielleicht animiert ein erfolgreiches schottisches Referendum auch die Waliser und Nordiren (give Ireland back to the Irish), sich demnächst aus dem Staub zu machen. Das einstige Weltreich wäre atomisiert und auf seinen Ausgangspunkt, England, zurückgeworfen. Anschließend zerfällt Belgien in einen flämischen und wallonischen Staat, Korsika trennt sich von Frankreich, Katalonien und das Baskenland sagen Spanien adieu, Norditalien wird endlich den Mezzogiorno los. Hurra! Und dann? 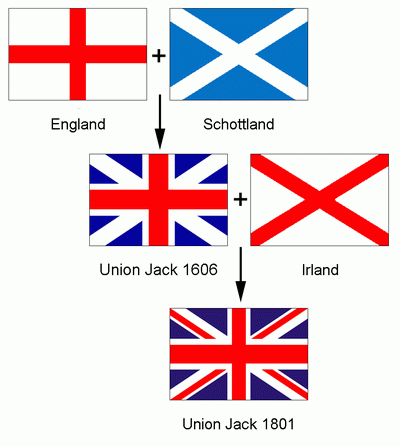 Die
Entstehung des Union Jacks
[Quelle: Wikipedia, Urheber: JW1805, Bild ist public domain] 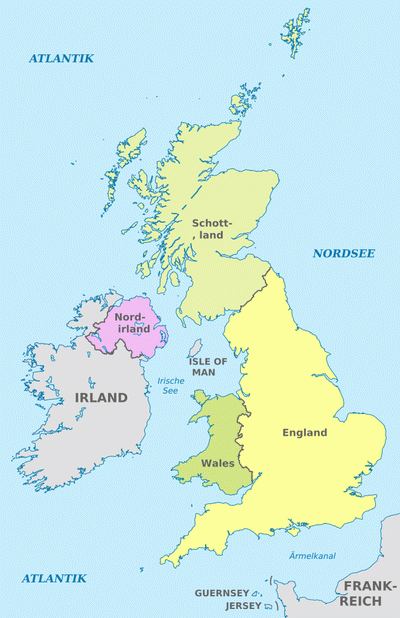 Das
Vereinigte Königreich - so, wie es heute aussieht
[Quelle: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0-Lizenz, Urheber: TUBS] Um es mit Goethe zu sagen: "Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust." Einerseits bin ich für das Selbstbestimmungsrecht der Menschen. Wenn die Basken, Katalanen, Flamen oder Schotten unbedingt unabhängig werden wollen - bitteschön. Schließlich haben sich ja auch Tschechen und Slowaken nach dem Fall des Eisernen Vorhangs friedlich getrennt. Die Welt ist daran bekanntlich nicht zugrunde gegangen. Zerrüttete Ehen mit Zwang aufrechterhalten schafft auf längere Sicht meist mehr Probleme als eine rasche Scheidung. Anders ausgedrückt: Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Andererseits frage ich mich: Was soll dieser Rückfall in die Kleinstaaterei? Glaubt man in den nach Unabhängigkeit strebenden Regionen tatsächlich, dass dadurch alles gut wird? Die historischen Erfahrungen sagen uns nämlich das Gegenteil. Ein zerstückeltes Europa droht zum Spielball anderer Mächte zu werden. Putin würde sich gewiss freuen. Wären die politischen Kleingebilde überhaupt ökonomisch lebensfähig? Könnten sie sich gegen Angriffe verteidigen? Welche unvermeidbaren Kosten entstehen? Schließlich braucht jeder souveräne Staat eine eigene Regierung, Polizei, Armee, Verwaltung und unter Umständen auch eine eigene Währung. Zugegeben, keine unüberwindlichen Hürden, man kann im Verbund mit anderen Nationen alles irgendwie regeln. Haben wir ja, auch wenn es hie und da immer wieder hakt, in Europa nach 1945 zur Genüge bewiesen. Stichworte: EU, Nato. Doch wird die Situation durch die Unabhängigkeit zahlreicher Gebiete wirklich besser als vorher? Ich würde keine Region mit juristischen Taschenspielertricks oder gar Gewalt an der Ausrufung der Unabhängigkeit hindern (solange sie ordnungsgemäß in einer freien und allgemeinen Abstimmung vom Volk beschlossen wird). Dennoch ist die Frage, wohin sich das Ganze eigentlich entwickeln soll, berechtigt. Ist mit den Unabhängigkeitsbestrebungen nicht vielmehr eine egoistische Entsolidarisierung verbunden? Die Katalanen glauben, sie würden vom spanischen Staat ausgesaugt. Ökonomisch auf sich allein gestellt ginge es ihnen besser, behaupten die Unabhängigkeitsbefürworter. Die reichen Flamen wollen nicht ständig die verarmte Wallonie alimentieren. Die Norditaliener sind es leid, die Mittel- und Süditaliener zu unterstützen. Nationaler Pathos spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Die stolzen Basken, die schottischen Bravehearts etc. Doch Vorsicht: Separatismus führt schnell zum Ethnizismus und damit zur Ausgrenzung. Die unabhängig gewordenen ehemaligen Minderheitsgebiete wären plötzlich mit eigenen Minderheiten konfrontiert: Kastilier in Katalonien, Engländer in Schottland, Wallonen in Flandern usw. Mit den allseits bekannten Problemen: Wird die Sprache der jeweiligen Minderheit als Amtssprache anerkannt? Wachsen die Kinder in der Schule zweisprachig auf? Oder wird Zwang ausgeübt? Es ist überdies eine Illusion, prosperierende Regionen könnten sich ohne gravierende Folgen abspalten. Denn was passiert mit den zurückgelassenen Wallonen oder Süditalienern? Wovon sollen die ohne den heute praktizierten innerstaatlichen Finanzausgleich leben? Wären sie angesichts ihrer prekären ökonomischen Situation überhaupt weiterhin existenzfähig? Neben den prosperierenden Regionen könnten sich daher mitten in Westeuropa so etwas wie "failed states" entwickeln. Süditalien wäre beispielsweise schutzlos der Mafia ausgeliefert, weil es sich für die Restitaliener als nahezu unmöglich herausstellt, eine funktionierende Polizei und Justiz aufrechtzuerhalten. Oder es kommen gefährliche populistische Regime an die Macht, Kopien vom Schlage eines Viktor Orbán oder einer Marine Le Pen. Demokratie bloß noch pro forma, aber nicht de facto. Es liegt auf der Hand, dass durch die Abspaltung der Reichen die Armut der ohnehin schon Armen spürbar wächst. Was mit chronisch defizitären Regionen langfristig geschieht, sehen wir doch andernorts zur Genüge. Wollen wir das haben? Ich meine, nein. Die Unabhängigkeitsbestrebungen und die damit verbundene Entsolidarisierung ist die logische Konsequenz des dominierenden Neoliberalismus. Menschen sind für ihn lediglich Kostenfaktoren. Und wer nichts einbringt, den Leistungsträgern somit nur auf der Tasche liegt, ist im Grunde überflüssig. Er rentiert sich nicht, ist scheinbar nutzlos. Am besten wird man ihn irgendwie los, schiebt ihn ab - wenn man kann über die Landesgrenze oder wenigstens ins Hartz IV-Ghetto. Die Reichen hingegen ziehen sich zunehmend in Gated Communities zurück. In Amerika inzwischen ein weitverbreiteter Trend. Demnächst auch bei uns? Der Separatismus errichtet politische Grenzen, wo bislang keine existierten. Ein kluger Schachzug: Die "Low Performer" werden nicht abgeschoben, sondern kurzerhand ausgesetzt. Wie an der Autobahn-Raststätte: Sag beim Abschied leise Servus. Würde sich Padanien gegen die absehbare Armutszuwanderung aus dem Süden abschotten, aus Norditalien gewissermaßen eine riesige Gated Community? Das ist naheliegend. 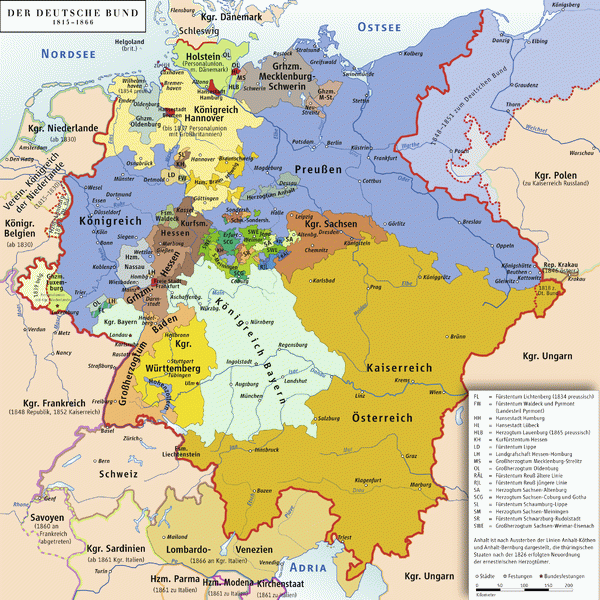 Kleinstaaterei,
das hatten wir schon einmal - und haben es aus gutem Grund
abgeschafft Kleinstaaterei,
das hatten wir schon einmal - und haben es aus gutem Grund
abgeschafft[Quelle: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0-Lizenz, Urheber: ziegelbrenner] Staaten und Bündnisse wie die Europäische Union garantieren Frieden und Wohlstand. Sofern man es richtig macht. Ohne Solidarität kann keine Gemeinschaft überleben. Doch wo steht geschrieben, dass Brüssel - analog zu Franz Kafkas "Das Schloss" - unbedingt der gewaltige, undurchschaubare bürokratische Apparat bleiben muss? Anstatt Regionalisierung ist Demokratisierung das Gebot der Stunde, etwa durch mehr direkte Demokratie. CETA oder TTIP könnten verhindert werden, gäbe es bei uns Volksabstimmungen wie in der Schweiz. Wir dagegen sind beinahe hilflos unseren Repräsentanten ausgeliefert, die uns in dieser eminent wichtigen Frage aber gar nicht repräsentieren, sondern wie gehabt bloß den Willen einer einflussreichen Minderheit befolgen. Die Ergebnisse würden vermutlich ganz anders aussehen, könnten wir direkt über die uns betreffenden Angelegenheiten entscheiden. Die Schweiz, obgleich in vier Sprachgebiete unterteilt, ist daran nicht zugrunde gegangen. Im Gegenteil, ohne die klug austarierte Basisorientierung wäre die Schweiz womöglich längst auseinandergedriftet. Die Folgen des Separatismus verschlimmern paradoxerweise die landauf, landab beklagten Zustände des Turbokapitalismus. In den wohlhabenden, aber politisch viel erpressbarer gewordenen Regionen könnten die Großkonzerne noch dreister agieren als bislang. So wäre etwa die fiktive "Pfälzische Republik" auf Gedeih und Verderb der BASF ausgeliefert. Allein der Wink mit dem Zaunpfahl (Verlegung des Ludwigshafener Hauptsitzes ins Ausland) macht jede Regierung - gleich welcher Couleur - sofort gefügig, denn die Alternative dazu wäre der sichere Staatsbankrott. Die Realität ist ebenfalls ernüchternd: "Mehr als 50 Prozent des schottischen Grund und Bodens gehören knapp 500 Familien." [5] Nennenswerte Industrie ist dort nicht vorhanden, und das Nordseeöl wird zwangsläufig irgendwann zur Neige gehen. Schottland könnte sich, wie zum Beispiel das von der Bevölkerungszahl her ähnlich dimensionierte Israel, zu einem Standort für Hochtechnologie entwickeln. Immerhin plant die heutige schottische Regionalregierung, bis zum Jahr 2020 100 Prozent des Stroms mit Erneuerbaren Energien zu produzieren. Doch wenn der Sprung misslingt, wenn private Investoren ausbleiben, wenn der Handel aufgrund der Randlage oder etwaigen Währungsproblemen versiegt, was dann? Nicht alle Regionen werden sich zu Hochtechnologiestandorten entwickeln. Jedenfalls nicht alle gleichzeitig. Es wird, siehe oben, ein wachsendes ökonomisches Gefälle zurückbleiben. Allerdings künftig unausgeglichen durch Überweisungen anderer, denn das war ja der tiefere Sinn der Unabhängigkeit. In meinen Augen führen die Unabhängigkeitsbestrebungen in eine Sackgasse. Manches würde besser, aber vieles wohl deutlich schlechter. Die Unabhängigkeitsbestrebungen sind lediglich ein Ventil, über das Druck aus dem Kessel entweicht, aber sie sind keine Lösung. Worauf sie uns allerdings hinweisen, ist die Notwendigkeit der Änderung des Bestehenden. So wie bisher kann es nicht bleiben. Fruchtbarer wäre demzufolge, die Ursachen der Unzufriedenheit, aus der diese Unabhängigkeitsbestrebungen resultieren, zu bekämpfen. Die Geschichte lehrt: Nur gemeinsam sind wir stark. Doch wenn Gemeinsamkeit so buchstabiert wird, wie es momentan in der Eurozone geschieht (Stichworte: Austerität, rasant wachsende Ungleichheit von Einkommen und Vermögen, teilweise extrem hohe Arbeitslosigkeit), braucht man sich über den Druck im Kessel nicht zu wundern. ---------- [1] Saarkurier-Online vom 08.09.2014 [2] Wikipedia, Autonome Pfalz [3] Merkur-Online vom 13.08.2012 [4] Die Zeit-Online vom 10.04.2014 [5] taz vom 13.09.2014 |
