
| Home
| Archiv
| Impressum 08. März 2015, von Michael Schöfer Eine gemeinsame EU-Armee? EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker fordert die Gründung einer gemeinsamen europäischen Armee, mit ihr könne Europa glaubwürdig auf eine Bedrohung des Friedens reagieren. Juncker will seinen Vorschlag ausdrücklich als Signal an Moskau verstanden wissen. Damit kann man "Russland den Eindruck vermitteln, 'dass wir es ernst meinen mit der Verteidigung der Werte der Europäischen Union'." [1] Finanziell gesehen steht die Europäische Union einer Bedrohung von außen keineswegs so hilflos gegenüber, wie allgemein angenommen und vielleicht auch suggeriert wird. Das europäische Bruttoinlandsprodukt übersteigt mit 17,4 Billionen US-Dollar sogar das der USA (16,8 Bil. $) und ist mehr als achtmal so hoch wie das russische (2,1 Bil. $). Bei den Militärausgaben sieht das Ganze etwas anders aus, hier liegen die Vereinigten Staaten mit 640,2 Mrd. US-Dollar weit vor allen anderen Ländern, im Vergleich dazu betragen die Militärausgaben der EU bloß 43,6 % und die von Russland lediglich 13,7 %. Dessen ungeachtet bleibt festzuhalten: Die 28 EU-Mitgliedstaaten geben dreimal so viel Geld fürs Militär aus wie Russland. Ginge es allein darum, bräuchte sich Europa kaum vor einem Angriff fürchten, zumal ja im Nato-Bündnisfall die amerikanischen Armeen hinzukommen. Die 28 Mitgliedstaaten der Nato (nicht völlig deckungsgleich mit den 28 EU-Mitgliedstaaten) gaben 2013 sage und schreibe 949,3 Mrd. US-Dollar fürs Militär aus - knapp elfmal so viel wie Russland.
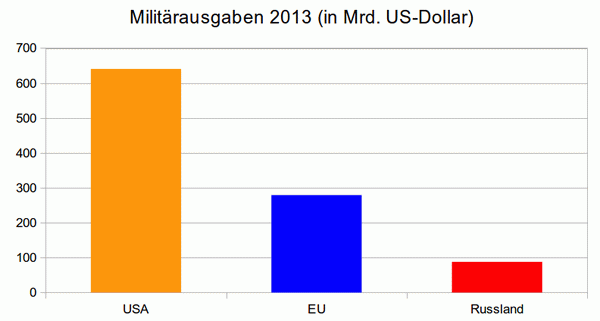 Zahlen sind das eine, die Verwendung von Haushaltsmitteln das andere, die Militärausgaben der Europäischen Union werden nämlich höchst ineffizient verwendet. Nach einer Studie "verschwenden die EU-Staaten durch den zersplitterten Markt für Rüstungsgüter viel Geld. Darin rechnen die Berater von McKinsey vor, dass sich die EU-Staaten sechsmal so viele unterschiedliche Waffensysteme leisten wie die USA, obwohl ihre Wehretats zusammengerechnet nur 40 Prozent des US-Budgets ausmachen. So betrieben die europäischen Armeen 14 unterschiedliche Kampfpanzer, die US Army nur einen, die Europäer 16 verschiedene Kampfjets, die Amerikaner nur sechs. 'Angesichts der hohen Fixkosten von Rüstungsgütern ist diese Fragmentierung eindeutig ineffizient', schreiben die Autoren (...). Langfristig könnten die Staaten demnach rund 30 Prozent sparen, wenn sie bei der Rüstungsbeschaffung enger zusammenrückten. Bei gesamten Rüstungsausgaben von 43 Milliarden Euro im Jahr 2012 wären das immerhin 13 Milliarden." [5] Dahinter verbergen sich natürlich handfeste ökonomische Interessen, weil jedes Land eifersüchtig über die eigene Rüstungsindustrie wacht. Kooperation wird zwar seit langem gefordert und oft versprochen, lässt aber faktisch immer noch zu wünschen übrig. Junckers Vorschlag kollidiert deshalb massiv mit den Interessen der Rüstungsindustrie. Die Europäer müssten zwangsläufig etliche Hersteller zusammenlegen, sobald sie sich auf weniger Waffenmuster konzentrieren. Man würde dann also beispielsweise die französische "Rafale" oder den deutsch-britisch-italienisch-spanischen "Eurofighter" oder den schwedischen "Gripen" beschaffen - und nicht wie bisher alle drei gleichzeitig. Bei den Panzern hieße die Alternative entweder "Leopard" (Deutschland) oder "Challenger" (Großbritannien) oder "Leclerc" (Frankreich). Gegenwärtig verzichten die Verteidigungsminister zugunsten der Waffenproduzenten auf kostensparende Synergieeffekte. Waffen und Ersatzteile sind aufgrund kleiner Stückzahlen teurer als notwendig, die Ausbildung ist wegen der Vielzahl der Systeme aufwendig und Munition gelegentlich inkompatibel. Viel gravierender als bei der Industrie würden jedoch die Einschnitte im Bereich der Politik ausfallen. Heute entscheidet jeder der 28 EU-Mitgliedstaaten nach eigenem Gusto, ob und wie er seine Armee einsetzt. Bei einer gemeinsamen EU-Armee würden unterschiedliche Militärtraditionen, heikle Verfassungsfragen und abweichende außenpolitische Motive aufeinanderprallen. In Deutschland muss etwa das Parlament über jeden Bundeswehreinsatz abstimmen, in Frankreich entscheidet darüber der Staatspräsident, das Parlament ist dort zunächst nur zu unterrichten (lediglich eine förmliche Kriegserklärung oder Auslandseinsätze, die länger als vier Monate andauern, bedürfen der Zustimmung der Abgeordneten). Meiner Ansicht nach wäre hierzu die Schaffung einer europäischen Regierung, die vom Volk oder vom EU-Parlament gewählt wird, unentbehrlich. Es müsste zwangsläufig zu erheblichen Änderungen beim EU-Vertrag sowie den nationalen Verfassungen kommen. Doch wir können uns ja nicht einmal innerhalb der Eurozone zu einem europäischen Finanzministerium, einer einheitlichen Wirtschaftspolitik und einem wie auch immer gearteten Finanzausgleichsmechanismus durchringen. Wie man dann den historisch erklärbaren Interventionismus Frankreichs und Großbritanniens mit der ebenso verständlichen Zurückhaltung Deutschlands in einer gemeinsamen Armee zusammenführen will, ist mir ehrlich gesagt vollkommen schleierhaft. Die Hindernisse, die Junckers Vorschlag zu überwinden hat, sind demzufolge gewaltig. Dabei haben wir die Frage, ob eine gemeinsame Armee überhaupt wünschenswert ist, noch nicht einmal erörtert. Selbstverständlich gibt es, völlig unabhängig von der konkreten Machbarkeit, sowohl gute Argumente dafür als auch gute Argumente dagegen. Einerseits könnte sich die EU von ihrem ökonomischen Potential her zur größten Militärmacht der Welt entwickeln. Allerdings erscheint das wenig erstrebenswert, es verleitet - siehe USA - nur dazu, dieses Potential auch global einzusetzen. Mit allen daraus resultierenden Konsequenzen. In diesem Fall droht der EU, noch mehr als bisher, die militärische Verwicklung in zahlreiche Konflikte. Aufrüstungsspirale und Überdehnungsgefahr inklusive. Andererseits könnten die Europäer bei einer effizienteren Nutzung der vorhandenen Mittel eigenständiger agieren. Ein Europa, das sich notfalls alleine verteidigen kann, wäre nicht länger bloß ein Anhängsel der USA. Das Misstrauen gegenüber Putins Russland hat jedenfalls den Weg für eine intensive Diskussion geebnet. Man sollte den Gedanken an eine gemeinsame europäische Armee weder kategorisch zurückweisen noch vorschnell begrüßen. Die politischen Implikationen von Junckers Vorschlag könnten die EU mehr verändern, als das in den vergangenen dreißig Jahren geschehen ist. Bislang bestand die EU-Politik aus vielen kleinen Schritten, die von Juncker befürwortete EU-Armee käme freilich einem großen Sprung gleich. Gewissermaßen eine tiefgreifende Revolution von oben. Die langsame Evolution der vergangenen Jahrzehnte wäre schlagartig dahin. ---------- [1] Die Welt vom 08.03.2015 [2] SIPRI, Military Expenditure Database, Excel-Datei mit 856 kb [3] Wikipedia [4] Wikipedia, Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt [5] Handelsblatt vom 26.06.2013 |
