
| Home | Archiv
| Impressum 09. Mai 2015, von Michael Schöfer Absurde Ergebnisse des Mehrheitswahlrechts Die Menschen mögen es ja gerne eindeutig, das mühsame Ringen um Mehrheiten und das unablässige Suchen von Kompromissen genießt den schlechten Ruf des Schacherns. In Italien gilt neuerdings ein Wahlrecht, das der stärksten Partei einen Bonus verschafft und ihr im Parlament die absolute Mehrheit garantiert. Das als notorisch unregierbar geltende Land soll durchgelüftet werden, doch es gibt gravierende demokratietheoretische Einwände. [1] Andere liebäugeln mit der Einführung des Mehrheitswahlrechts, das schaffe ebenfalls klare Mehrheiten. Die Regierenden könnten so ganz auf die lästige Kompromisssuche verzichten und ohne Rücksichtnahme auf Koalitionspartner bestimmen, wo es langzugehen hat. Tradition hin oder her, das Paradebeispiel Großbritannien zeigt, zu welch absurden Ergebnissen das Mehrheitswahlrecht führen kann, ja systembedingt sogar führen muss. Der Wählerwille wird krass verfälscht, das britische Parlament spiegelt nicht unbedingt die Meinung des Volkes wider, große Teile davon bleiben oftmals fast völlig unberücksichtigt. Im Gegensatz zur Verhältniswahl gilt nämlich beim Mehrheitswahlrecht in den Wahlkreisen das Prinzip "the winner takes all". Der Kandidat mit den meisten Stimmen bekommt das Mandat, alle anderen gehen leer aus. Beispiel: Bei den Unterhauswahlen im Jahr 1951 erhielt die bis dahin regierende Labour Party mit 13,95 Mio. Stimmen (48,8 %) den größten Wählerzuspruch, was ihr 295 Mandate bescherte. Als eigentlicher Wahlsieger ging jedoch die Conservative Party über die Ziellinie. 12,66 Mio. Stimmen (44,3 % - sage und schreibe 1,29 Mio. weniger als Labour) reichten für 302 Mandate und die Regierungsübernahme. Premierminister Clement Attlee wurde damals trotz eines Zugewinns von fast 700.000 Stimmen als Hausherr von Number 10 Downing Street durch Winston Churchill abgelöst. [2] Sehen wir uns nun die britische Unterhauswahl vom 7. Mai 2015 etwas genauer an. Von den insgesamt 30,7 Mio. abgegebenen Stimmen erhielten:
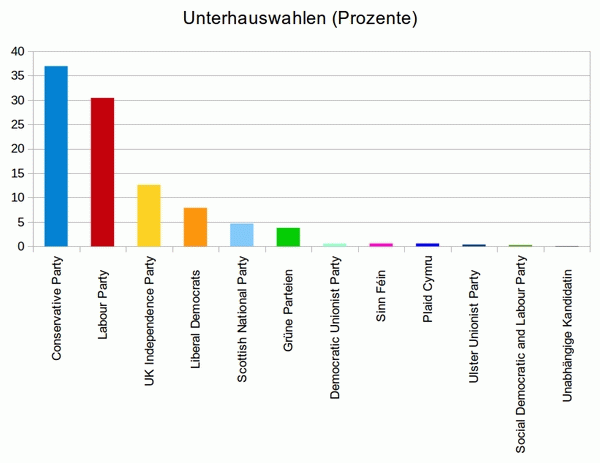 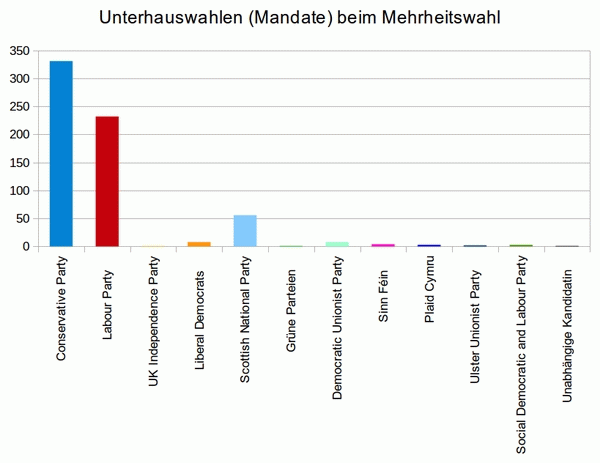 Die Verwerfungen, die das Mehrheitswahlrecht naturgemäß mit sich bringt, sind offenkundig: Die UK Independence Party (UKIP) bekommt lediglich ein Mandat, obgleich sie landesweit 12,6 Prozent der Stimmen erhielt. Im Gegensatz dazu hat die Scottish National Party (SNP) mit einem Stimmenanteil von gerade mal 4,7 Prozent schier unglaubliche 56 Mandate eingefahren. Hier spielen natürlich regionale Besonderheiten eine Rolle - und das Prinzip "the winner takes all". So kann sich die nordirische Regionalpartei Sinn Fein über vier Mandate freuen (die sie allerdings nicht annimmt, weil ihre Abgeordneten dann einen Treueeid auf die Königin leisten müssten), während die Grünen nur ein Mandat haben, obwohl sie mehr als sechsmal so viele Stimmen bekamen. Und mit 36,9 Prozent die absolute Mehrheit zu erreichen, wie es David Camerons Tories schafften, ist beim Verhältniswahlrecht unmöglich. Bei einer reinen Verhältniswahl ohne Sperrklausel sähe die Sitzverteilung wie folgt aus (nach D'Hondt):
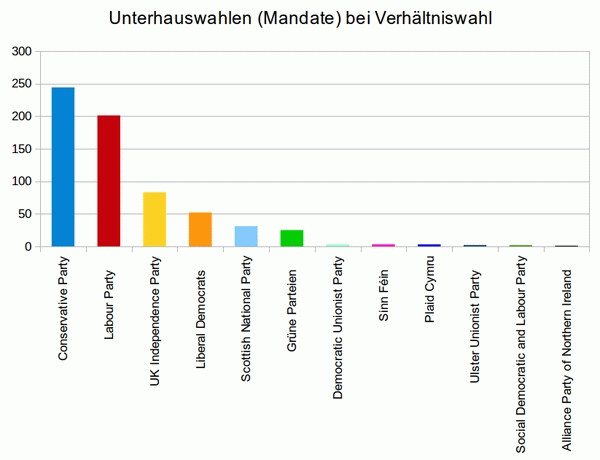 Doch Demokratie ist anstrengend. Und je repräsentativer ein Parlament, desto eher werden dort die unterschiedlichen Meinungen in der Bevölkerung nach ihrem jeweiligen Gewicht berücksichtigt. Nein, das mühsame Austarieren von Strömungen ist mir wesentlich sympathischer als eine kompromisslose Basta-Politik, die den politischen Willen des Souveräns (alle Staatsgewalt geht bekanntlich vom Volke aus) krass verzerrt. In der Regel sind dann auch die Brüche nach einem Regierungswechsel nicht so drastisch. Außerdem bedarf Macht der Kontrolle, andernfalls führt sie unweigerlich zu Machtmissbrauch. David Cameron kann jetzt mit vergleichsweise mageren 36,9 Prozent der Stimmen durchregieren (sofern ihn die eigene Unterhausfraktion lässt). Dass er in bestimmten Sachfragen womöglich nahezu zwei Drittel der Bevölkerung gegen sich hat, braucht ihn nicht zu stören. Im britischen Parlament gilt wie andernorts: Mehrheit ist eben Mehrheit. Aber das Mehrheitswahlrecht ist meiner Meinung nach bedenklich und im Grunde undemokratisch. ---------- [1] siehe Scheibchenweise Demokratieabbau vom 05.05.2015 [2] Wikipedia, Britische Unterhauswahlen 1951 [3] Hinweis: Nur Stimmen, die zu Mandaten führten, Quelle: Wikipedia, Britische Unterhauswahlen 2015, Landesweite Ergebnisse und BBC, Ergebnis im Wahlkreis North Down [4] Berechnung mit Online-Rechner der Akademie für Arbeits- und Sozialrecht Ruhr-Westfalen GmbH |
