
| Home
| Archiv
| Impressum 13. Juni 2017, von Michael Schöfer Mehrheitswahlrecht verzerrt den Wählerwillen Dass die Listenverbindung von Emmanuel Macrons Partei La République en Marche (28,21 %) und dem verbündeten Mouvement démocrate (4,11 %) mit lediglich 32,3 Prozent der Stimmen Aussicht hat, in der zweiten Runde zur Wahl der Nationalversammlung 400 bis 455 der insgesamt 577 Abgeordnetenmandate zu erobern und damit einen Sitzanteil von 69 bis 79 Prozent zu erreichen, ist unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten äußerst bedenklich, weil dann das neugewählte Parlament die Heterogenität des Wahlvolks nur noch stark verzerrt widerspiegelt. Die repräsentative Demokratie ist in diesem Fall nicht mehr repräsentativ, der Wählerwille wird verfälscht. Zum Vergleich: Die zweitstärkste Partei (Les Républicains) und ihre Verbündeten kommen zwar auf einen Stimmenanteil von 21,6 Prozent, ihnen werden aber nur 70 bis 110 Mandate vorhergesagt (Sitzanteil 12 bis 19 %). Das Verhältnis 3:2 bei den absoluten Stimmen der ersten Runde verwandelt sich im Parlament vielleicht in ein 3,6:1- oder unter Umständen sogar in ein 6,5:1-Verhältnis. Ursache ist das in Frankreich geltende Mehrheitswahlrecht. Die Ergebnisse der Unterhauswahl in Großbritannien sind nicht ganz so drastisch, verfälschen aber ebenfalls den Willen des Wahlvolkes. So sind Theresa Mays Tories mit einem Stimmenanteil von 42,3 Prozent nur knapp an der absoluten Mehrheit der Mandate gescheitert. Gelingt die Duldung durch die DUP, regieren zwei Parteien, die gemeinsam auf 43,2 Prozent der Stimmen kommen, damit aber über 50,3 Prozent der Parlamentsmandate verfügen (siehe Tabelle 1). Jeremy Corbyns Labour-Party, obgleich an Stimmen dicht dahinter (40,0 %), hat realistisch betrachtet keine Koalitionsoptionen. Er müsste, die Konservativen ausgenommen, schon mit allen anderen Parteien koalieren, um Premierminister zu werden - eine politisch extrem unwahrscheinliche Konstellation. Kurios: Die Scottish National Party kommt mit drei Prozent auf 35 Mandate, während die Liberal Democrats mit mehr als doppelt so vielen Stimmen nur 12 Mandate erhalten. Noch kurioser: Die UK Independence Party bekommt kein einziges Mandat, obgleich die Partei mehr als zweieinhalb Mal so viele Stimmen hat wie Sinn Féin, die sieben Mandate erobert (aber aus politischen Gründen kein einziges davon wahrnimmt). Bekanntlich gilt auch in Großbritannien das Mehrheitswahlrecht.
**Insgesamt in allen Wahlkreisen abgegebene Stimmen (auch von in der Tabelle unberücksichtigten Parteien, die rechnerisch 0,0 % bekommen haben und bei der Sitzverteilung leer ausgegangen sind) ***absolute Mehrheit: 326 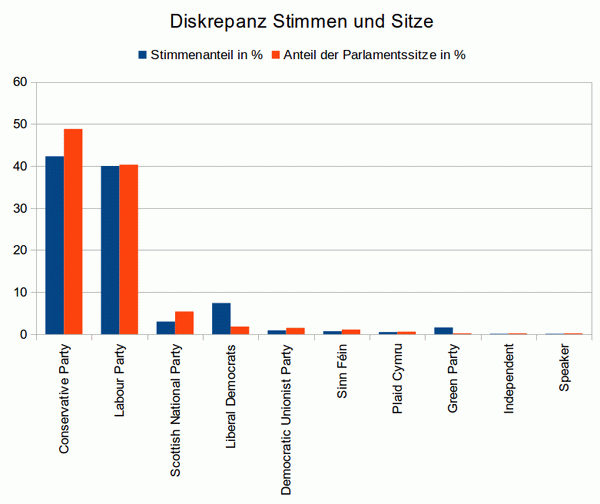
Schauen wir uns das Ergebnis der Unterhauswahl genauer an und vergleichen es mit dem Ergebnis, wenn auf der Insel das Verhältniswahlrecht gelten würde. Bei einem reinen Verhältniswahlrecht ohne Sperrklausel könnte Jeremy Corbyn mit einer Dreierkoalition regieren. Gemeinsam hätten Labour Party, Scottish National Party und Liberal Democrats 332 von insgesamt 650 Mandaten. Die absolute Mehrheit. Conservative Party und Democratic Unionist Party (286 Mandate) könnten dagegen keine Koalition bilden. Selbst wenn sie UKIP dazunehmen, erreichen sie bloß 298 Mandate und sind damit noch immer weit von einer regierungsfähigen Mehrheit entfernt (siehe Tabelle 2). Die Tories müssten die Koalition mit den Liberaldemokraten erneuern, was Letztere aber entschieden ablehnen. Theresa May brächte vermutlich keine Regierung zustande. Würde wie in Deutschland zusätzlich eine Sperrklausel von fünf Prozent gelten, kämen ganze drei Parteien ins Unterhaus (momentan sind es acht plus der Speaker plus eine Unabhängige). Die Koalitionsmöglichkeiten wären in dem Fall denkbar einfach: Entweder regieren Conservative Party und Liberal Democrats (360 Mandate) oder Labour Party und Liberal Democrats (343 Mandate). Die Chancen von Corbyn, Premierminister zu werden, wären jedenfalls bei einem Verhältniswahlrecht wesentlich besser als unter dem derzeit gültigen Mehrheitswahlrecht.
Natürlich hat das Mehrheitswahlrecht in Frankreich und Großbritannien Tradition, es dürfte wohl kaum abzuschaffen sein. Aber man sollte sich wenigstens stets den Nachteilen dieses Wahlrechts bewusst sein. Es beschert meist klare Mehrheiten und zwingt dadurch seltener zu Kompromissen, außerdem sind Kursänderungen nach einem Machtwechsel mitunter krass. Das französische Volk will Emmanuel Macron offenbar eine Chance geben, seine Ideen zu verwirklichen. Doch was ist, wenn die Bürger schon nach kurzer Zeit merken, dass sie mit der Politik Macrons nicht einverstanden sind? Die Amtszeit des Präsidenten dauert fünf Jahre, genauso lange wie die Legislaturperiode der Nationalversammlung. In dieser Zeit gibt es kein institutionelles Korrektiv, es bleibt dann allein die Presse als "vierte Gewalt". Absolute Macht neigt zum Missbrauch derselben, gerade deshalb ist Machtkontrolle unerlässlich. Wenn freilich die Machtkontrolle durch das Wahlrecht erheblich behindert wird, passiert das, was man gemeinhin als "Durchregieren" bezeichnet. Bei einer mit der gleichen Machtfülle ausgestatteten Marine Le Pen wäre das ein extrem unangenehmer Gedanke. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
