
| Home
| Archiv
| Impressum 25. Oktober 2017, von Michael Schöfer Shinzō Abe hätte keine Mehrheit mehr Kürzlich habe ich mich zum Vorschlag von Hans Peter Bull, ehedem Professor für Öffentliches Recht, Bundesdatenschutzbeauftragter und Landesinnenminister, geäußert. [1] Bull hatte angesichts der Vielzahl von Abgeordneten im neuen Deutschen Bundestag eine Änderung des Wahlrechts vorgeschlagen: Seiner Meinung nach sollte auf die Verrechnung der Wahlkreissitze mit den Wahllisten verzichtet werden, der Fachbegriff für diese Form des Wahlrechts lautet "Grabensystem" (wie durch einen Graben getrennt). Beim Durchrechnen der Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 wurde durch die Gegenüberstellung des aktuellen Wahlrechts und dem Vorschlag von Bull deutlich, dass dies zu einer nichtrepräsentativen Zusammensetzung des Parlaments führen würde. Das Grabensystem wird bereits in anderen Ländern praktiziert, etwa in Japan. Und voilà, die Unterhauswahl vom 22. Oktober 2017 hat alle meine Bedenken bestätigt. Im "Land der aufgehenden Sonne" werden die Abgeordneten in 289 Wahlkreisen jeweils per Mehrheitswahl gewählt, die restlichen 176 Sitze werden nach dem Parteienproporz verteilt, ohne dass es hierbei zu einer Verrechnung von Wahlkreisen mit den Wahllisten kommt. Das Grabensystem bevorzugt eindeutig die stärkste Partei, weil sie sich selbst bei starken Stimmenverlusten meist die Mehrheit in den Wahlkreisen, in denen 62 Prozent der Mandate vergeben werden, sichern kann. Ob eine Partei einen Wahlkreis mit 55 oder 45 Prozent holt, ist vollkommen irrelevant. Ein Abgeordneter ist ein Abgeordneter - egal mit welcher Mehrheit er gewählt wird. In Japan hat die Liberaldemokratische Partei (LDP) von Ministerpräsident Shinzō Abe trotz eines mageren Stimmanteils von lediglich 33,3 Prozent im Verhältniswahlsegment (entspricht in Deutschland der Zweitstimme) insgesamt 281 Mandate erobert, das sind 60,4 Prozent der Abgeordnetensitze. Grund: Ihre nahezu unangefochtene Vorherrschaft in den Wahlkreisen, die LPD gewann im Mehrheitswahlsegment 215 Mandate (faktisch hinzuzurechnen sind noch drei von ihr aufgestellte Unabhängige). Achillesferse der Opposition: Sie ist in den Wahlkreisen traditionell schwach und eroberte daher bloß 40 von 289 Wahlkreisen, demgegenüber fielen 226 an die beiden Regierungsparteien LPD und Kōmeitō (23 weitere gingen an Unabhängige). [2] Wäre die Sitzverteilung wie in Deutschland ausschließlich nach dem Proporz gegangen, hätte Shinzō Abe keine Mehrheit mehr, stattdessen kann er sich über die absolute Mehrheit freuen. Andernfalls wäre es vielleicht sogar zu einem Regierungswechsel gekommen, denn bei einem reinen Verhältniswahlrecht stünden den Regierungsparteien nur 216 Mandate zu, den zugegebenermaßen sehr heterogenen Oppositionsparteien jedoch 249 Mandate.
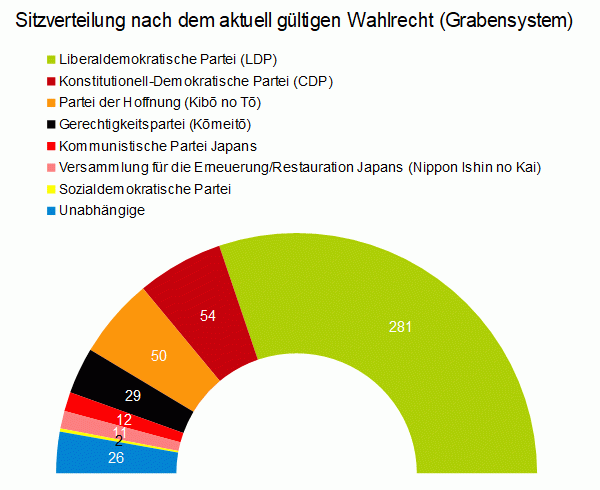 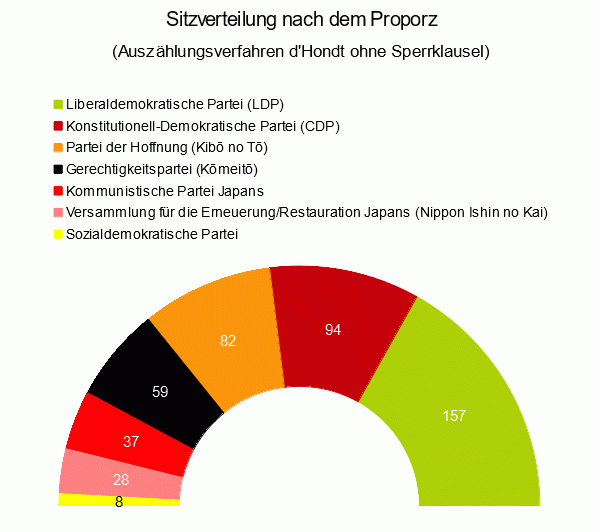 Es liegt auf der Hand, dass das Grabensystem ungerecht ist. Kein Wunder, wenn die LDP seit 1955 mit nur zwei kurzen Unterbrechungen (1993-1994 und 2009-2012) an der Regierung ist. Die Abwahl einer Regierung ist zwar nicht völlig unmöglich, aber furchtbar schwer. Ein derartiges Wahlrecht ist inakzeptabel, solange man Wert darauf legt, dass das Parlament den Pluralismus in der Bevölkerung abbildet. ---------- [1] siehe Das parlamentarische System muss repräsentativ bleiben vom 05.10.2017 [2] Wikipedia, Shūgiin-Wahl 2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
