
| Home
| Archiv
| Impressum 16. April 2021, von Michael Schöfer Die Parteien der sozialen Kälte Sie haben kein Gespür für die sozialen Nöte anderer, nur so ist die unverhohlene Freude von Union und FDP über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Berliner Mietendeckel zu erklären. Wenn Mieter jetzt wieder mehr zahlen müssen, wissen sie, wem sie das zu verdanken haben: Den Politikern, die bloß über bezahlbaren Wohnraum schwadronieren ("schnelleres und günstigeres Bauen"), aber nichts dafür tun. Doch für die Kläger könnte sich das Urteil als Pyrrhussieg erweisen, denn das Bundesverfassungsgericht hat den Mietendeckel bloß aus formalen Gründen zurückgewiesen - das Land Berlin sei dafür schlicht nicht zuständig, denn das Mietrecht falle gemäß Grundgesetz in die alleinige Kompetenz des Bundes. Der Bundesgesetzgeber ist aber keineswegs an der sozialen Ausgestaltung des Mietrechts gehindert. "Der Gesetzgeber kann insbesondere mit der entsprechenden Ausgestaltung des bürgerlichen Rechts soziale und andere Ziele verfolgen, indem er für die Vertragsgestaltung Vorgaben macht und ihre Beachtung und Durchsetzung sichert. Das kann den Rückgriff auf verwaltungsrechtliche Instrumente rechtfertigen, wenn er dazu dient, das im Kern privatrechtlich konzipierte soziale Mietrecht für ungebundenen Wohnraum abzusichern und seine Durchsetzung zu erleichtern." Das gelte auch hinsichtlich der Miete auf angespannten Wohnungsmärkten. [1] Bereits in seinem Beschluss vom 18. Juli 2019 zur Mietpreisbremse hat das Bundesverfassungsgericht klargestellt: "Bei der Abwägung der betroffenen Belange, insbesondere des Eigentums als Sicherung der Freiheit des Einzelnen im persönlichen Bereich einerseits und des Eigentums in seinem sozialen Bezug sowie seiner sozialen Funktion andererseits, verfügt der Gesetzgeber, angesichts des Umstands, dass sich grundrechtlich geschützte Positionen gegenüberstehen, über einen weiten Gestaltungsspielraum. Dieser wird durch die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse geprägt. Insbesondere kann der Gesetzgeber die jeweiligen Verhältnisse und Umstände auf dem Wohnungsmarkt berücksichtigen und dabei den unterschiedlich zu gewichtenden Interessen bei einer Miethöhenregulierung im Bereich von Bestandsmieten einerseits und Wiedervermietungsmieten andererseits Rechnung tragen. (…) Die Eigentumsgarantie gebietet nicht, einmal ausgestaltete Rechtspositionen für alle Zukunft in ihrem Inhalt unangetastet zu lassen. Der Gesetzgeber kann im Rahmen der Bestimmung von Inhalt und Schranken des Eigentums einmal geschaffene Regelungen nachträglich verändern und fortentwickeln, auch wenn sich damit die Nutzungsmöglichkeiten bestehender Eigentumspositionen verschlechtern. Die Abänderung kann durch Gründe des öffentlichen Interesses unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit gerechtfertigt sein. Die Gründe, die für einen solchen Eingriff sprechen, müssen so schwerwiegend sein, dass sie Vorrang vor dem Vertrauen des Eigentümers auf den Fortbestand seiner Rechtsposition haben, die durch den Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG innewohnenden Bestandsschutz gesichert wird." [2] Der Berliner Mietendeckel könnte daher, je nach Ausgang der Bundestagswahl, demnächst bundesweit ein Comeback erleben. Die Freude über die drastischen Mietpreiserhöhungen (in Berlin sind Mieten zwischen 2009 und 2019 um 104 Prozent gestiegen) könnte den Gegnern des Berliner Mietendeckels also noch im Halse stecken bleiben. Insbesondere, da sie keine Alternativen anzubieten haben, bislang erschöpfte sich nämlich das Engagement für den Wohnungsbau in haltlosen Versprechungen. "Wir starten eine Wohnraumoffensive: 1,5 Millionen neue Wohnungen und Eigenheime." So steht es im Koalitionsvertrag von CDU, CSU, SPD. Im Schnitt wären das pro Jahr 375.000 neue Wohnungen. Doch von diesem Ziel sind die Regierungsparteien weit entfernt. [3] Vom Bau erschwinglichen Wohnraums ganz zu schweigen.
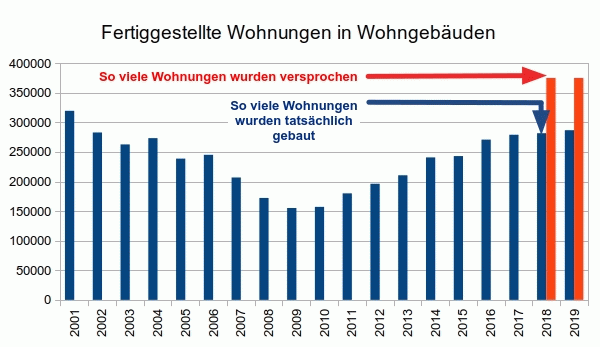 Es ist besonders betrüblich, dass man in der Öffentlichkeit zur Zeit vor allem darüber diskutiert, wer Kanzlerkandidat der Union wird (Laschet oder Söder). Es wäre - vor allem für die Mieter - viel hilfreicher, über die soziale Ausgestaltung des Mietrechts zu reden, denn was die Parteien konkret planen, erfahren wir momentan leider nicht. CDU und CSU haben ja bislang für die Bundestagswahl noch nicht einmal einen Entwurf des Wahlprogramms vorgelegt. Insofern führt die Diskussion über Personen an den realen Problemen vorbei. Aber vielleicht ist genau das gewollt. Ob es den Parteien der sozialen Kälte am Ende tatsächlich nutzt, steht allerdings auf einem anderen Blatt. ----------
[1]
Bundesverfassungsgericht, Beschluss
vom 25. März 2021, 2 BvF 1/20
[2]
Bundesverfassungsgericht, Beschluss
vom 18. Juli 2019, 1 BvL 1/18
[3] Bundesregierung, Koalitionsvertrag 19. Wahlperiode, Seite 16, PDF-Datei mit 8,7 MB [4] Statistisches Bundesamt, Statistik der
Baufertigstellungen (aktuellere Daten liegen noch nicht vor)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
